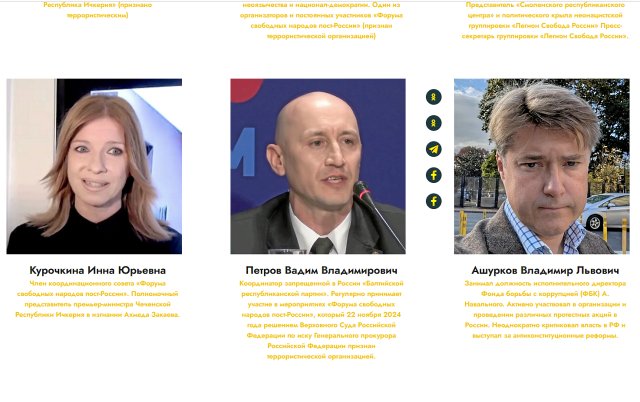Bündnis gegen homophobe Anfeindungen
24 Organisationen wollen sich für die Rechte von Lesben und Schwulen einsetzen
Dem einen fallen Schwule als gebildet und zuvorkommend auf, aber trotzdem findet er sie abstoßend. Der andere meint, Homosexuelle könnten Frauen besser verstehen, »weil sie sich weiblicher geben als wir«; und ein Dritter erklärt, solange, wie Schwule sich zivilisiert benehmen, könne man nichts sagen. Der Film »Respekt und Zumutung« von Katrin Aue zeigt den Nährboden für solche Übergriffe auf Schwule und Lesben, wie am 18. Oktober vergangenen Jahres in der Berliner U-Bahn, als ein Mann seinen Freund küsste und deshalb übel zusammengeschlagen wurde.
»Eine Gesellschaft kann es sich nicht erlauben, andere auszugrenzen«, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), selbst einer der prominentesten Homosexuellen in der Metropole, die sich gerne vielfältig und weltoffen gibt. »Nein, es ist leider nicht alles toll in der Stadt«, konstatierte er. Deshalb lud der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) in das Rote Rathaus 24 Organisationen aus der Politik und Wirtschaft, Bildung und Zivilgesellschaft ein, um ein »Bündnis gegen Homophobie« zu gründen.
Alexander Zinn vom LSVD begrüßt es, dass sich künftig nicht nur die Betroffenen an die Öffentlichkeit wenden, sondern ein Bündnis aus der Mitte der Gesellschaft Unterstützung anbiete. Wenn Dieter Glietsch als Polizeipräsident eine intensivierte Präventionsarbeit zusichert oder Mehmet Matur als Integrationsbeauftragter des Berliner Fußballverbandes verspricht, Homophobie in den Teams zu thematisieren, dann wollen sie damit Zeichen setzen. Die Jüdische Gemeinde und der Zentralrat der Sinti und Roma hingegen sind selbst Anfeindungen ausgesetzt und wollen mit dem Bündnis künftig enger zusammenrücken, um sich gegenseitig zu unterstützen. Ein solcher Zusammenschluss aus allen gesellschaftlichen Bereichen sei dringend notwendig, meint Bastian Finke vom schwulen Anti-Gewaltprojekt Maneo. »Die schwul-lesbische Community brauche Hilfe.«
Allerdings wunderte sich Saideh Saadat-Lendle von der Lesbenberatung LesMigraS, dass sie nicht eingeladen worden sei, und der Zusammenschluss von türkischstämmigen Homosexuellen GLADT oder die Opferberatung Reach Out, die langjährige Erfahrung in der Antidiskriminierungsarbeit haben, auch nicht. Als Grund dafür vermutet Saadat-Lendle unterschiedliche Auffassungen, wie mit Ressentiments aus dem Migrantenmilieu umgegangen werden solle.
Wie notwendig eine gegenseitige Unterstützung hingegen ist, zeigt der Sozialforscher Wilhelm Heitmeyer in einer Studie von 2007 auf, wonach ein Drittel der Bevölkerung sich davor ekele, wenn sich Schwule küssten. Als Ursache für Homophobie macht Heitmeyer ausgeprägte Männlichkeitsbilder aus, die gleichgeschlechtliche Liebe nicht vorsehen, weltanschauliche Bedenken oder religiösen Fundamentalismus, der Homosexualität als Strafe Gottes auffasst. Diese Vorurteile will das »Bündnis gegen Homophobie« durchbrechen. Wie schwer das ist, wissen Aktivisten wie Ernst-Detlef Mücke von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. »Noch vor 15 Jahren gab es massive Probleme mit den Behörden, wenn Homosexualität im Schulunterricht thematisiert wurde.« Jeder Schritt sei erkämpft worden.
Heute ist Torsten Manske, Präsidiumsmitglied bei Hertha BSC und Gründungsmitglied des »Bündnisses gegen Homophobie«, stolz darauf, dass die Hertha-Junxx der erste schwul-lesbische Fanclub in der Bundesliga waren. Der einzige Fußballprofi, der sich bislang öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hat, war der Engländer Justin Fashanu, der in den 80er Jahren unter anderem für Nottingham Forest spielte. Fashanu erlebte daraufhin einen Spießrutenlauf, und als er den Druck nicht mehr aushielt, erhängte er sich. Kein Einzelfall, bestätigte Alexander Zinn vom Lesben- und Schwulenverband: »Die Suizidrate ist bei Homosexuellen siebenmal höher als in der Mehrheitsgesellschaft.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.