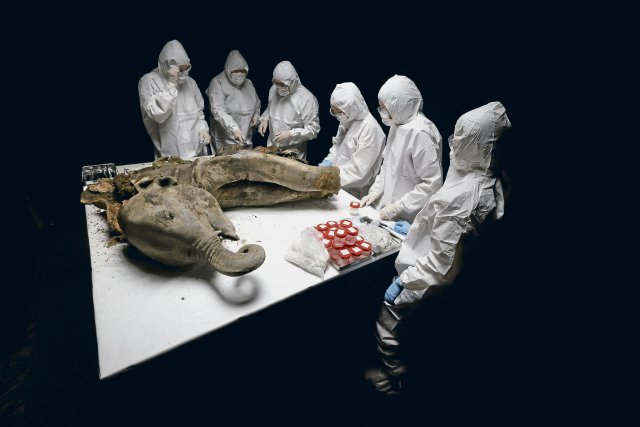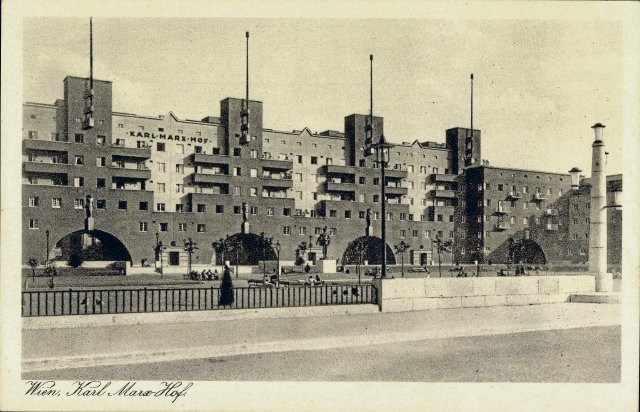Bankfiliale im Hörsaal
Fragwürdige Kooperationen zwischen privaten Unternehmen und staatlichen Hochschulen
In Nordrhein-Westfalen kann man als Privatunternehmen Studiengänge mieten. Die Firmen bieten dann gleichsam als Filialen die Studiengänge den staatlichen Fachhochschulen an, die auf bereits vorhandenen staatlichen Studiengängen basieren. Die beteiligten Hochschulen kriegen in diesem Franchise-System nicht nur für die Weitergabe der Studienkonzepte Geld, sondern profitieren noch einmal indirekt davon: Die privatwirtschaftlich ermöglichten Studienplätze werden den jeweiligen Hochschulen zugerechnet, die auch die Abschlüsse verleihen. Und für jeden geschaffenen Studienplatz bekommen die Hochschulen ja Geld aus dem Hochschulpakt von Bund und Ländern.
Das zuständige Landesministerium stellt auf ND-Anfrage die Vorteile für die Studierenden heraus: »Franchise im Hochschulbereich hat das Ziel, insbesondere in stark nachgefragten Studiengängen Angebote für ein berufsbegleitendes Studium durch eine Kooperation mit privaten Bildungseinrichtungen zu schaffen, die ansonsten nicht angeboten werden könnten. Allerdings sind diese Angebote nicht kostenlos und stehen damit im Widerspruch zu der in diesem Jahr von der rot-grünen Landesregierung beschlossenen Abschaffung der Studiengebühren. Eingeführt wurde das Modell von der alten schwarz-gelben Landesregierung. Bislang stört sich jedoch in dem heute SPD-geführten Wissenschaftsministerium niemand an der Praxis. In NRW ist man offenbar froh über jeden neu geschaffenen Studienplatz. Das Wissenschaftsministerium in Düsseldorf habe die FH Südwestfalen sogar aufgefordert, »Gas zu geben«, vermeldete jüngst die »Financial Times Deutschland« (FTD).
Auch Sachsen ist für PPP im Hochschulbereich ein gutes Pflaster, wie Recherchen des Studieninfo-Portals Studis Online ergaben. An insgesamt fünf – und somit der Hälfte – seiner Hochschulen gibt es zwischen einem und elf (Mittweida) Studienangebote, die zusammen mit privatwirtschaftlichen Akteuren organisiert sind.
Eine der Vorreitereinrichtungen ist die AMAK (»Akademie für multimediale Ausbildung und Kommunikation«) in dem Städtchen Mittweida. In ihrer Selbstdarstellung präsentiert sich die Akademie als ein »außergewöhnliches Bildungsunternehmen«, da sie »in der für hochschulnahe Einrichtungen noch seltenen Rechtsform einer Aktiengesellschaft« arbeitet. »Hochschulnah« bedeutet: Die AMAK bietet mit Kooperationspartnern in verschiedenen deutschen Städten nach dem Motto »privat studieren, staatlich abschließen« (so der Münchener Partner Campus M 21) Ausbildungen an, die am Ende mit einem Titel der Hochschule Mittweida gekrönt werden.
Die »Partnerakademien« der AMAK sind zahlreich und auf ganz Deutschland verteilt.. Der mit Abstand größte Teil des Studiums findet bei ihnen und nicht an der Hochschule statt. Das Studienmodell wird deshalb als dezentral und von der Hochschule nur gelenkt bezeichnet. Gegründet wurde die AMAK vor annähernd 12 Jahren auf Anregung des damaligen sächsischen Wissenschaftsministers Joachim Mayer. »Entsprechend der Gründungsintention, nach der der Freistaat finanziell entlastet werden sollte, ist die Hochschule nicht Gesellschafter. Sie nimmt aber durch Kontroll- und Aufsichtsgremien starken Einfluss. Die Gesellschafter der AMAK AG sind Professoren der Hochschule, Branchenexperten sowie Vertreter der örtlichen sächsischen Wirtschaft«, heißt es in der Selbstdarstellung der Akademie.
Der Landeshaushalt wird ent-, und deshalb die Studierenden belastet. Zwischen 17 000 und knapp 25 000 Euro kosten die vier Semester in Medienstudiengängen an den Partnerakademien. Wichtig zu wissen ist dabei, dass eine Immatrikulation erst zum fünften Semester erfolgt. Vorher kann es also keine Bafög-Förderung geben.
Ende Februar dieses Jahres wurde aus den Antworten des Landeswissenschaftsministeriums auf parlamentarische Anfragen des SPD-Abgeordneten Holger Mann ersichtlich, dass in den besagten Studiengängen Lehrveranstaltungen so gut wie gar nicht von den Hochschulen selbst abgehalten werden. Das ist für Letztere natürlich reizvoll, denn im Rahmen des Hochschulpaktes zählen auch hier die gewonnenen Studierenden.
Holger Mann sieht diesen nur flüchtigen Kontakt zwischen Studierenden und Hochschule kritisch. Einem KMK-Beschluss zufolge soll »ein wesentlicher Teil der dem Hochschulabschluss zugrundeliegenden Ausbildung in der unmittelbaren Verantwortung, d. h. durch eigene Leistungen der verleihenden Hochschule« stattfinden. Die erwähnten Modelle jedoch »stellen primär auf die Sicherung der Qualität des Studiums mittels (Abschluss-)Prüfungen und die Anerkennung von extern erworbenen Leistungen ab und bewegen sich in einem gesetzlichen Rahmen, der durchaus als Graubereich bezeichnet werden kann«, so Mann. Der SPD-Parlamentarier möchte jedoch auch festgehalten wissen: »Die PPP-Studiengänge wurden in einem Zeitraum gegründet, der das Akkreditierungswesen noch nicht kannte. Sie wurden vielmehr durch ministerielle Genehmigungen während der CDU-Alleinregierung auf den Weg gebracht.«
Das war vor rund zehn Jahren. Nun muss das von derselben Partei besetzte Wissenschaftsministerium zumindest bezüglich Mittweida gegensteuern. Der Entwurf des »Sächsischen Hochschulentwicklungsplans bis 2020« von Ende April, der ND vorliegt, enthält eine Passage, in der sehr deutlich Kritik am bisherigen Kooperationsmodell geübt wird: »So interessant das Modell der PPP ist, muss die Hochschule Mittweida auf eine vernünftige Relation dieser Studiengänge zur allgemeinen staatlichen Ausbildungsverpflichtung der Hochschule achten. Der staatliche Ausbildungsbereich muss zumindest ein Volumen umfassen, das der Hochschule ausreichend Gewicht und Einfluss auf die Qualität der Ausbildung bei den Kooperationspartnern gibt und den Fortbestand der Hochschule als eigenständige staatliche Fachhochschule rechtfertigt. Das Ministerium fordert die Hochschule Mittweida daher auf, den PPP-Bereich nicht noch weiter auszubauen.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.