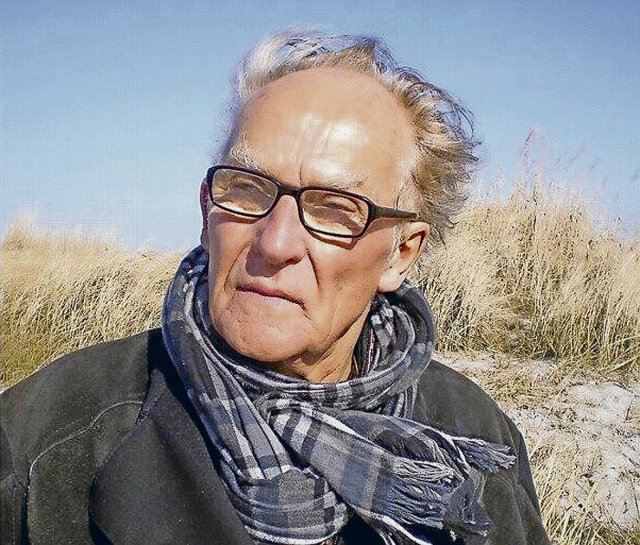»Zwei Seelen, ach!«
Unsere Bedürfnisse und wir: Woher kommen Konsumwünsche? Und passen sie in eine solidarische Gesellschaft?

Solidarische Ökonomien orientieren sich nicht an Profit, sondern an menschlichen Bedürfnissen. Aber immer wieder wenden Kritiker ein, dass Menschen endlos Bedürfnisse hätten, die niemals erfüllt werden könnten. Dieses Vorurteil verdient eine Widerrede.
»Na, wat will se denn?«, fragt jedes Mal der Butt den Fischer, dessen Frau Ilsebill, wie dieser stets betont, nicht so will, »as ik wol will«. Soll der freigelassene verwunschene Prinz zunächst den Wunsch nach ordentlichen Wohnverhältnissen erfüllen - das Paar im Märchen bewohnt aus ungeklärten Gründen einen »Pisspott« - so ist Frau Ilsebill mit dem Haus genauso schnell unzufrieden, wie nacheinander mit dem Schloss und ihren Ämtern als König, Kaiser oder Papst. Als sie gottähnlich zu werden wünscht, stürmt die See apokalyptisch; das Paar endet wieder im Nachttopf.
Vom Märchen »De Fischer un si Fru« lässt sich einiges lernen: Erstens, dass es nicht gut ausgeht, wenn man immer mehr will. Zweitens findet sich hier eine frühe Vorwegnahme heutiger empirischer Forschungen über Menschen, die sich auf materielle Dinge konzentrieren: Sie sind mit ihrem Leben statistisch signifikant unzufriedener, fühlen sich innerlich unsicherer, sind kränker, eher von Sucht und Depressionen geplagt und mäkeln auch noch an ihren Mitmenschen herum.
Die nörgeln an uns? Nun, die dritte unangenehme Weisheit dieses Märchens lautet: Wir sind beides. Wir sind sowohl der »innere Richter«, den schon Adam Smith beschreibt, als auch der »innere Schweinehund«, der uns allen nur zu gut bekannt ist. Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, drückte es etwas poetischer Goethe im Faust aus.
Bequem fliegen oder teurer Bahnfahren?
»Womit wir bereits den aus unserer Sicht entscheidenden Punkt erreicht hätten: Alle wissen, dass Vielfliegerei absurd ist, dennoch scheint es enorm schwer zu sein, den finanziell ausgepolsterten Verlockungen der Reiseindustrie zu widerstehen«, so die Bremer Kommune Alla Hopp in einer Stellungnahme. Natürlich falle es auch ihnen nicht leicht, den Bremer Billigflughafen links liegen zu lassen, denn Bahnfahrten seien in der Regel bis zu achtmal teurer als Billigflüge, und wer den preiswerteren Bus wähle, frage sich spätestens hinter Madrid, nach über 35 Stunden Fahrt, ob es wirklich klug war, eine solche Ochsentour anzutreten.
Doch wären unsere Wünsche wirklich unendlich, so der Ökonom Wolfgang Hoeschele, hieße die dazugehörige wirtschaftsmathematische Gleichung, dass die Kapazität, unsere Wünsche zu befriedigen, geteilt durch unendlich, immer gegen Null tendieren müsste - jede Bemühung nach deren Befriedigung wäre vergeblich. Und die Depression programmiert.
Tatsächlich spricht das Bundesgesundheitsministerium von vier Millionen akut behandlungsbedürftigen Depressiven, ist die »depressive Episode« zum häufigsten Grund für Fehlzeiten geworden, und vermeldet bezogen auf das Jahr 2009 die Techniker Krankenkasse, bei fast einem Drittel aller Studentinnen seien psychische Probleme diagnostiziert worden.
Glückliche Menschen konsumieren weniger
Doch natürlich sind unsere Wünsche nicht unendlich. Wir leben nicht ewig, und Bedürfnisbefriedigung braucht Zeit. Und Menschen werden nicht depressiv, weil sie Filme auf Röhrenbildschirmen sehen, sondern, weil sie zu viel arbeiten, um sich den Flachbildschirm leisten zu können, oder weil sie sich gesellschaftlich nicht anerkannt fühlen ohne dieses Statusobjekt. Denn kennen wir das nicht alle? Wir wünschen uns eine neue Hose, ein neues Handy oder einen neuen PKW - und denken dabei stets an den Moment, wo andere dies an uns sehen und uns dafür bewundern.
Werbefachleute sind sich der Bedeutung nicht-materieller Bedürfnisse absolut bewusst - darum versuchen sie, uns zu überzeugen, dass Kaufen uns nicht-materielle Vorteile bringt. In den Worten der Werbefachfrau Nancy Shalek: »Werbung, wenn sie gut gemacht ist, lässt Menschen sich als Verlierer fühlen, wenn sie ein bestimmtes Produkt nicht besitzen.« Und der Ex-Werbespezialist Frédéric Beigbeder verriet: »In meinem Job will niemand Ihr Glück, denn glückliche Menschen konsumieren nicht.«
Von einem »Happiness-Paradox« spricht der italienische Ökonom Stefano Bartolini, der anhand von Daten für die USA von 1975-2004 zu dem Schluss kommt, dass die mit dem Wachstum einhergehenden negativen Effekte wie Neid, Misstrauen oder Einsamkeit die positiven überwogen - die Menschen also reicher und unglücklicher wurden.
Bartolini weist zudem darauf hin, dass von Menschen als eigene Handlungsmöglichkeiten nur noch Bereicherung sowie Erfolg im Wettbewerb gesehen werden. Während die meisten im Westen ihr Leben als von Freiheit geprägt beschreiben würden, erlebten sie es als Druck und Zwang. Auf diese Weise das moderne Versprechen von Freiheit zu brechen, sei die bitterste Enttäuschung des ökonomischen Überflusses.
Das wohl größte Missverständnis in Bezug auf Bedürfnisse ist die Ideologie, wir hätten nur Bedürfnisse nach Konsum, und nicht auch nach Tätigsein. Dabei zählt der Gebrauch der eigenen Fähigkeiten sogar zu den von Abraham Maslow benannten Grundbedürfnissen. Und wie kaum ein anderer hat Karl Marx betont, dass Menschen sich im Tätigsein verwirklichen. Doch so habe sich Marx die Menschwerdung durch Arbeit nicht vorgestellt, schreibt der Naturphilosoph Klaus Meyer-Abich: »Statt Erfüllung Rückenprobleme, Atembeschwerden und psychische Erkrankungen. Dass immer mehr Menschen unter ihrer Arbeit leiden, liegt auch daran, dass sie ihnen keinen Sinn mehr vermittelt.« Er selbst achte darauf, stets aus innerer Motivation heraus zu arbeiten.
Diese aber, so die erstaunliche Nachricht aus der Mitarbeitermotivationsliteratur, lässt sich nicht zum Geld addieren: Lust auf Kreativität geht durch das Belohnungssystem genauso verloren wie Hilfsbereitschaft oder soziale Verantwortung. Forscher erklären sich dieses Phänomen damit, dass sie einen Wechsel in der Wahrnehmung der Menschen über die eigenen Gründe, warum sie etwas tun, produzieren. Genau darauf aber beruht der Kapitalismus: Marktwirtschaft ist der Versuch, ein ökonomisches System ohne innere Motivation zu erreichen. Das erzeugt innere Leere.
Über Bedürfnisse lässt sich nur schwer streiten
»Die Freiheit, weiterzumachen«, nennt Margarita Tsomou in der taz die Entscheidung von Journalisten, Technikern und Grafikern der griechischen Eleftherotypia, ohne Gehälter und in Eigenregie ihre Zeitung wieder herauszugeben: 56 Seiten mit einer Auflage von 40 000. Solidarische Drucker helfen aus, Fotografen und Agenturen liefern unentgeltlich. Tsomou sieht diese Form »sturer Selbstaktivität« als paradigmatisch für einen neuen Trend in der griechischen Zivilgesellschaft.
Und in diesem Sinn ist auch die Occupy-Bewegung interessant, eben gerade insofern sie der Versuchung widersteht, sich auf Forderungen reduzieren zu lassen - charakterisiert sie sich doch durch die Form der dauerhaften Platzbesetzungen und der damit verbundenen Organisierung des Alltäglichen durch eine tätige Wiederaneignung von Raum und Zeit ohne Entfremdung durch Geld und Tauschlogik. Wer das Leben aber sinnvoll füllt, muss es nicht mit Konsumartikeln vollstopfen.
Doch was ist nun gut und was ist schlecht? Die Gemeinschaft von Alla Hopp ist der Überzeugung, dass sich über Bedürfnisse auf einer bestimmten Ebene nur schlecht diskutieren lässt: »Die einen rauchen, die anderen finden Rauchen bescheuert. Für manche gehört der Kaffee am Bahnhof zu jeder guten Reise, andere empfinden genau das als überflüssigen Luxus.« Und doch sei nicht alles gleich gut. Darum versuchen sie, ohne Druck sich einen Rahmen zu schaffen, der den Blick darauf richtet, welche anderen Bedürfnisse womöglich hinter Konsumwünschen stecken. Und nicht zu verbieten, sondern sich in der Gesamtheit ihrer Bedürfnisse gegenseitig zu unterstützen.
Wer eine solche Gemeinschaft nicht hat, sollte genau dies mit sich selbst tun.
Friederike Habermann ist Volkswirtin und Historikerin. Seit den 1980er Jahren engagiert sie sich in sozialen Bewegungen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.