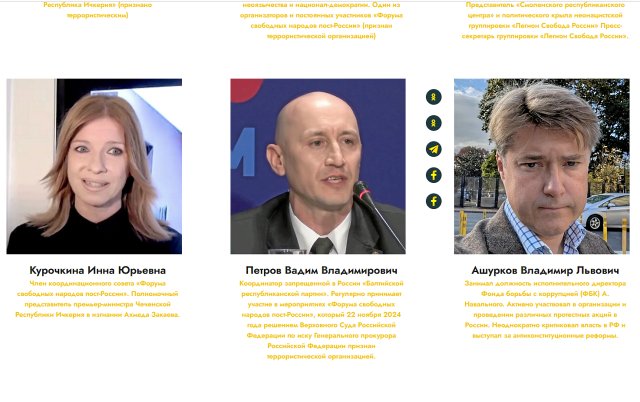- Politik
- Brüsseler Spitzen
Gefährliche Nähe zur Macht

Wie hat die Lebensmittellobby es eigentlich geschafft, die Ampelkennzeichnung von Nahrungsmitteln effektiv zu verhindern? Welche direkten Verbindungen hat der Medienkonzern Bertelsmann in das Europäische Parlament? Und was hat die Deutsche Bank damit zu tun, dass die europäischen Geldhäuser als Mitverursacher der Finanzkrise bei ihrer politischen Bewältigung mehr als glimpflich davonkamen? Diese und zahlreiche andere Fragen beantwortet der neue »LobbyPlanet Brüssel«. Soeben haben »LobbyControl« und »Corporate Europe Observatory« die Neuauflage dieses Stadtführers für die EU-Hauptstadt auf deutsch veröffentlicht. Die Lektüre macht deutlich, wie eng die Verflechtungen zwischen den EU-Institutionen und der Wirtschaft sind.
Diese Nähe ist ein großes Problem, zumindest in den Augen des ALTER-EU-Netzwerkes, in dem sich etwa 200 Organisationen für mehr Transparenz und Schranken für den Lobbyismus in Brüssel einsetzen. Denn anders als LobbyvertreterInnen oftmals behaupten, ist der Lobbyismus kein »Marktplatz der Ideen«, in dem alle Interessen gehört werden. Er begünstigt vielmehr sehr häufig diejenigen mit den größten Budgets - und das sind vor allem die Konzerne.
Wir haben nichts dagegen, dass die europäischen Großunternehmen ihre Sicht der Dinge in die politischen Prozesse einbringen. Aber zurzeit geraten gesamtgesellschaftliche Anliegen zu oft unter die Räder. Der durch die Ausgabe zu vieler kostenloser Verschmutzungszertifikate sinnlos gewordene EU-Emissionshandel ist dafür aktuell das beste Beispiel.
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Schon die Masse der WirtschaftslobbyistInnen spielt eine Rolle: Von den geschätzt 20 000 Lobbyisten in Brüssel sind 70 Prozent für die Wirtschaft und deren Verbände tätig. Das ist ein enormer Vorteil, gerade da weder Kommission noch Parlament ausreichend mit wissenschaftlichem Personal ausgestattet sind. In die Lücke springen oft InteressenvertreterInnen der Unternehmen. Sie suchen die Abgeordneten auf und fluten das Parlament mit Änderungsanträgen. UnternehmensvertreterInnen dominieren auch viele der etwa 1000 Expertengruppen, die die Kommission beraten. Der Rat der Expertengruppen hat gewichtigen Einfluss, oftmals bildet er die Grundlage für neue Gesetzesvorschläge der Kommission.
Die Europäische Union war genau genommen von Anfang an kein demokratisches Projekt. Die Kommission verhält sich zu oft als Dienstleister der europäischen Industrie. Mit ihren immensen Lobbybudgets - der geschätzte Umsatz der Brüsseler Lobbyindustrie beträgt eine Milliarde Euro jährlich - können die Unternehmen unter anderem ehemalige Kommissare und Kommissarinnen engagieren und sich damit Insiderwissen und Kontakte kaufen. Damit wird die gefährliche Nähe weiter vertieft.
Was ist zu tun? Allen voran die EU-Kommission muss aufhören, ihre Politik als abgehobenes Projekt zwischen wirtschaftlichen und politischen Eliten zu betreiben. Sie muss dafür unter anderem ihre Expertengruppen endlich ausgeglichen besetzen - das heißt, Fachleute aus der Zivilgesellschaft müssen gegenüber UnternehmensvertreterInnen mindestens gleichberechtigt repräsentiert sein. Ihren KommissarInnen und MitarbeiterInnen muss das Exekutivorgan die Seitenwechsel in lukrative Lobbytätigkeiten effektiv verbieten. Das Europäische Parlament braucht mehr wissenschaftliches Personal und muss seinen neuen Verhaltenskodex gegenüber LobbyistInnen und Lobbytätigkeiten konsequent umsetzen.
Generell müssen wir aber auch dafür sorgen, dass das gesamte europäische Gebilde auf demokratischere Füße gestellt wird. Dazu gehört auch eine europäische Öffentlichkeit, die es bisher nicht gibt - Bürgerinnen und Bürger, die nicht resigniert weghören, wenn über EU-Politik berichtet wird, sondern kritisch zuhören. Und - wenn nötig - auch aktiv werden, indem sie Proteste in das eigene Land tragen. Die Bewegung um das ACTA-Abkommen war der Beweis dafür, dass dies etwas bewirken kann.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.