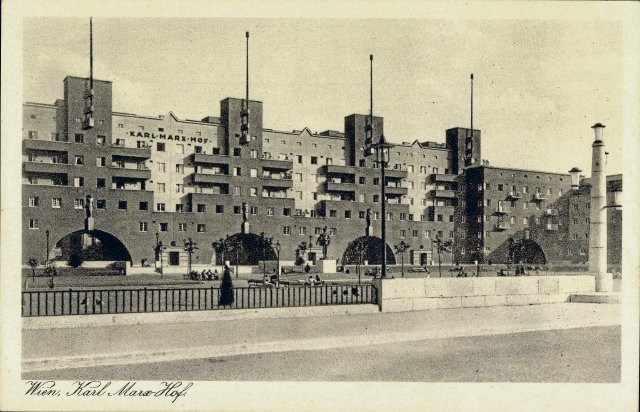„Machen darf ich alles, zahlen will es keiner“
Dennoch zeigt sich allgemein ein angeschlagenes Selbstwertgefühl. Mario Sammler (30 Jahre, verheiratet, zwei Kinder): „Ich habe niemals die Chance, die A12 (Gehaltseinstufung für Berufsschüler mit „klassischer“ Ausbildung in der BRD, d. A.) je zu bekommen.“ Der Diplomingenieur für Fertigungsprozeß-Gestaltung absolviert derzeit ein Studium für Berufspädagogik in Dresden. Studiengebühren 1000 DM. Alles, auch Unterbringung und Anreise, zahlt er selbst. „Am Ende habe ich ein Zertifikat, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob es anerkannt wird. Mir ist nahegelegt worden, mich noch um ein zweites Fach zu kümmern und eine Referendarzeit (bedeutet einen Monatslohn von ca. 1000 DM brutto, d. A.) zu machen“, ärgert sich der junge Mann, der zu Abschluß des Studiums bereits vier Jahre Lehrtätigkeit nachweisen kann: „Machen darf ich alles, zahlen will es keiner.“ Auch der Zwang zum Zweitfach will ihm nicht recht einleuchten: „Metalltechnik allein umfaßt mindestens sieben Lehrgebiete.“
Etliche seiner Kollegen verbergen ihr -verletztes- Selbstbewußtsein, '^vollen sich nicht öffentlich äußern.' Öie „Materie“ sei kompli^ ziert, der Schulleiter kenne ihre Standpunkte. Dieser, Heinz Knöpper, steckt mit Schulkonferenz, Personalrat und Lehrerrat mitten
im „schwierigen Verwaltungsakt der Umstrukturierung“, der „mindestens zwei Jahre“ dauern kann. Er zerbricht sich den Kopf, welche Schulformen sein Haus anbieten könnte. In der Rechnung schwankt die entscheidende Größe: Welche Forderungen stellt die Wirtschaft? Trotzdem hat Knöpper ein fast fertiges Konzept: eigene Kontakte zur Wirtschaft, zum Arbeitsamt, zu Handwerksinnungen. Fachgymnasiale Ausbildung in verschiedenen Berufsgruppen, Fachoberschule, Berufsfachschule - all das sollen Neubrandenburger Schulabgänger vor ihrer Tür finden.
Per Schulleiter ist nicht zimperlich mit Forderungen an die Kommune: „Ich erwarte konkret Mittel im Umfang von fünf Millionen. Habe das früh genug angemeldet. Unsere Ausstattung ist unzureichend, es fehlen moderne Labore.“ Er soll ziemlich sauer gewesen sein, daß der Bildungsträger Kommune im vergangenen Jahr bei seiner Zuschußsumme blieb und sie nicht aufrundete, als frisches Geld aus Bonn kam. Heinz Knöpper hofft, daß der „Aufschwung Ost“ 1992 der Beruflichen Schule die nötigen Mittel beschert. Bis dahin wird in der Ausbildung mitunter Trockenschwimmen gemacht bzw. „praktische Übung theoretisch vorbereitet“ und „das eine oder andere zeitlich anders eingeordnet“. Ein kleiner Trost: Für das Fach Ernährung/Hauswirtschaft steht schon eine funkelnde neue Küche bereit, für die Elektroniker ein Computerkabinett.
„Wir bemühen uns, die Schüler von all den Querelen und Problemen nichts merken zu lassen“, sagt Hannelore Schuster, Berufsschullehrerin, engagierte Gewerkschafterin. Aber die Lehrer können nicht ausbügeln, was „die ganzen Umstände“ bewirkten. Potentielle Berufsschüler sind in den Westen abgewandert. Eine Ausnahme bildet die Baubranche, deren Boom im Osten ja jeder erwartet. Im Metallbereich aber, früher in Neubrandenburg groß vertreten, war mit zwei Klassen zu je 28 Schülern gerechnet worden. Nur 27 Schüler traten dann wirklich an. Ein harter Schlag für die Lehrer, die damit überflüssig zu werden drohen. Allerdings, so Hannelore Schuster; „Der Bedarf kann sich rasch ändern. Dann fehlen Ausbilder, die man vergrault oder entlassen hat.“
Für eine vergessene Schule hält sie vor allem das Fachgymnasium, das in der Preise tötgeschwiegen und von den „ricTitigen Gymnasien“ in ?' der fyä&t diskreditiert wird (dessen'Äbscnlüsse seien angeblich nicht gleichwertig). Hannelore Schuster will persönlich das Gegenteil beweisen, schickte ihren
Sohn ans Fachgymnasium Bankwesen. Ohne die neuen vielfältigen und individuellen Wege ins Berufs-» leben zu unterschätzen, bemängelt sie etliches an dem zu schnellen Wandel auch,auf dem'Gebiet der Berufsausbildung: „Das Kultusministerium hat völlig vergessen, daß wir noch die Berufsausbildung mit
Abitur zu Ende führen müssen. Wir haben mehrere Klassen im 2. und 3. r Lehrjahr. Die ganze Strecke soll auslaufen, dabei kann das Fachgymnasium sie nicht ersetzen.“ Das ist auch die Meinung nicht weniger Berufsschullehrer im Westen, die auch nicht alles im Osten Bewährte zerschlagen sehen wollen.
Fotos: report
Das Klima an den Beruflichen Schulen der Stadt Neubrandenburg ist schwer zu definieren?'In den jungen Köpfen spuken wunderliche Interpretatippen 4er „westlichen Freiheit“. Nach Ansicht der Lehrer wäre zu erwarten gewesen, daß sich der Leistungsdruck der Marktwirtschaft deut-
lich in Disziplin und Lerneifer ummünzt. Das trat nicht ein. Sicherlich sind auch hieran „die Umstände“ mitschuld, wissen doch auch die Jugendlichen nicht, welche Chancen sie auf dem Arbeitsmarkt haben werden. Zudem, ein Mädchenpensionat ist die Schule fürwahr nicht. Schulleiter Knöpper: „Es gibt bei uns schon recht rauhbeinige Burschen, vor allem in der Branche Bauwesen.“
Die rauhbeinigen Burschen, die sich in der Pause im Gang drängen und die Aschenbecher belagern, sind zwar betont cool, einzeln aber freundlich und durchaus umgänglich. Sie wollen ihr Leben am richtigen Zipfel packen. Lehrerin Christiane Sitterle ist trotzdem besorgt: „Der unterschiedliche Status bringt soziale Spannungen. Manche kriegen Geld vom Arbeitsamt -350 DM. Manche kriegen gar nichts. Wer aus sanierten Betrieben kommt, für zwei Tage Theorie in der Woche, hat dagegen bis zu 1000 DM. Vor allem Familienväter tun mir leid, die trotz abgeschlossener Berufsausbildung nochmal neu anfangen müssen, weil sie entlassen sind und auch ihr alter Beruf nicht mehr gefragt ist...“ Schulleiter Knöpper ahnt, daß später „Standesunterschiede“ unter den Lehrlingen zutage treten, wenn die Schulformen deutlicher erkennbar werden. Jetzt machen ihm vor allem jene Sorgen, die aus einem überbetrieblichen Bereich kommen, obwohl er „die Ausbildungsgemeinschaft vom sozialen Anliegen her positiv“ findet. Die „außerbetrieblichen“ sind bunt zusam^ mengewürfelt, teils aus „verschwundenen“ (abgewickelten, geschlossenen) Betrieben. Sie haben keinen Ausbildungsvertrag mit einem Lehrmeister.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.