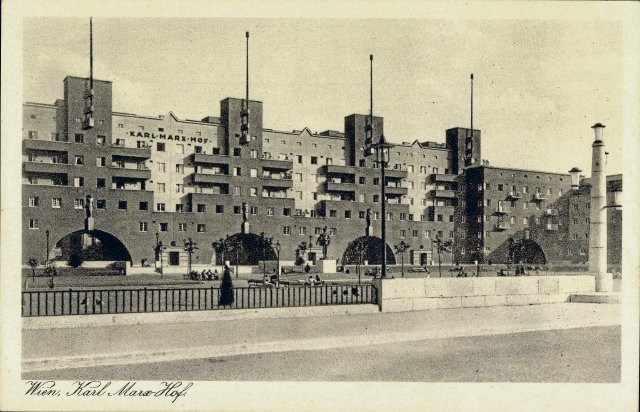- Wissen
- Nachträgliche Bemerkungen zum Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft in Berlin
Zwischen Modernisierungsanspruch und Wahrnehmungskrise
„Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung und Modernitätskrise“ lautete das Generalthema, das die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) ihrem diesjährigen Kongreß in der vergangenen Woche in Berlin (ND berichtete kurz darüber) vorangestellt hatte. Der Vorsitzende' des hochrangigen wissenschaftlichen Gremiums, Professor Dr. Benner (früher Universität Münster, jetzt Humboldt-Universität Berlin), tat sich in seinem Eröffnungsreferat allerdings schwer, nach einem ausgedehnten Ausflug in die Geistesgeschichte endlich der profanen Welt der Gegenwart angesichtig zu werden - ohne sie freilich in den verbliebenen Zehn Minuten seines Vortrags noch festen Schrittes betreten zu können. In ähnlicher Realitätsferne waren offenbar auch einige der anderen Hauptreferate angesiedelt, was einen Journalisten in der abschließenden Pressekonferenz zu der Frage veranlaßt hatte, ob man sich auf dem Kongreß nicht mehr in abgehobenen Bereichen der Abstraktion denn den niederen Gefilden der Wirklichkeit bewegt habe.
Vielleicht hing mit solcher Realitäts-Abstinenz jene Frage zusam-
men, die in den Diskussionsveranstaltungen und Pausengesprächen wohl am häufigsten - und auch mit Nachdruck - gestellt wurde: Warum die DDR-Pädagogik als erziehungshistorisches Faktum auf diesem Kongreß - substantiell wie auch personell - so wenig repräsentiert war, und überhaupt die deutsch-deutsche Problematik, entgegen der allgemeinen Erwartung, so auffallend im Hintergrund blieb.
Professor Benner, der Vorsitzende der DGfE, entgegnete auf der Pressekonferenz wohl zu recht, daß die damit zusammenhängenden Fragen nicht durch besondere Veranstaltungen thematisiert werden sollten, sondern eigentlich Bestandteil aller Themenbereiche sein müßten. Ob dies auf dem Kongreß der Fall war, kann freilich in Zweifel gezogen werden.
Gelegenheit dazu wäre gewesen. Etwa im Zusammenhang mit jener büdungspolitischen Grundsatzerklärung „Zu Brennpunkten der Schulentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland“, auf die Benner als Beispiel für realitätsbezogene Arbeit der wissenschaftlichen Gesellschaft verwies. Sie hat-
te allerdings auf dem Kongreß selbst, wie zu erfahren war, keine Rolle gespielt, wurde indessen im nachhinein den Journalisten überreicht. Dabei ist diese Erklärung in der Tat bemerkenswert. In ihr werden bildungspolitische Sachverhalte benannt und Probleme aufgeworfen, mit denen man in der DDR bereits seine Erfahrungen hatte, bevor sie zum Anschlußgebiet wurde. Zum Beispiel dort, wo das „Stadt-Land-Gefälle“ im Bildungsangebot und die daraus resultierenden Bildungschancen angesprochen werden. Es wäre sicher lohnend - und effektiv in bezug auf rationelle Lösungsstrategien - die Entwicklung der ländlichen Zentralschulen in der DDR einer analytischen Betrachtung zu unterziehen (wenngleich man dann unvermeidlich auf die unbequeme Erkenntnis stoßen würde, daß grundsätzliche bildungspolitische Veränderungen ,in der Regel nur schwer zu erreichen sind ohne Veränderungen in den umfassenderen gesellschaftlichen Strukturen, in die sie eingebettet sind).
Oder: Wenn in der Grundsatzerklärung eine „vorberufliche Bildung“ gefordert wird, die „auf die Arbeitswelt hin orientiert und zur
Berufswahl befähigt“ - wer dächte da nicht sogleich an die polytechnische Bildung, wie sie 30 Jahre lang in den DDR-Schulen praktiziert wurde - wenn sie auch konzeptionell (zumindest der ursprünglichen Idee nach) viel weiter griff. Die „Einbeziehung-? außerschulischer Kooperationspartner“ empfiehlt die Erklärung der DGfE. Schon mal gehört?
Und schließlich wird einem tragfähigen „Konzept der Grundbildung höchste Dringlichkeit“ zugemessen. Ein Problem, das in der DDR immerhin Gegenstand einer jahrelangen theoretischen Diskussion war - wie immer man deren Ergebnisse auch einschätzen mag. Solche Entwicklungen und Denkansätze nicht zur Kenntnis zu nehmen und kritisch aufzuarbeiten, würde von einem bedenklichen Ausmaß an Ignoranz zeugen.
Daß die real existierende DDR-Pädagogik in weiten Bereichen selbst hinter den eignen Ansprüchen zurückgeblieben War, wenn schon nicht überhaupt versagt hat, kann kaum bestritten werden. Doch abgesehen davon, daß selbst Fehlentwicklungen lehrreich sein können, wäre es äußerst fruchtbar für künftige Entwicklungen des
deutschen Erziehungswesens, den für „Modernisierung“ tragfähigen Ansätzen nachzuspüren und die aus einer progressiven, wenn auch widerspruchsvollen Praxis entstammenden Erfahrungen aufzunehmen. Dies gilt beispielsweise für-die» Verwirklichung von Chancengleichheit in einem Einheitsschulsystem, .wie es weitblickende Reformer in den 60er, 70er Jahren in der Bundesrepublik und in Westberlin mit der integrierten Gesamtschule konzipiert hatten, aber leider nur in bescheidenen Ansätzen durchzusetzen vermochten. Wenn die DGfE nun - so ihre Erklärung - zu „sachangemessenen Entscheidungen für die Weiterentwicklung des Bildungssystems“ beitragen will, dann ist eigentlich schwer verständlich, warum sie eine „flächendeckende“ Einführung der Gesamtschule ebenso voreilig wie unbegründet als untauglich für die „Verwirklichung von Chancengleichheit“ und für die „Vermittlung von Kompetenzen zur gesellschaftlichen Partizipation“ erklärt.
Vielleicht ist es einfach „unmodern“, solche sozialismusverdächtigen Konzepte weiterzudenken. Eine Unmodernitätskrise?
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.