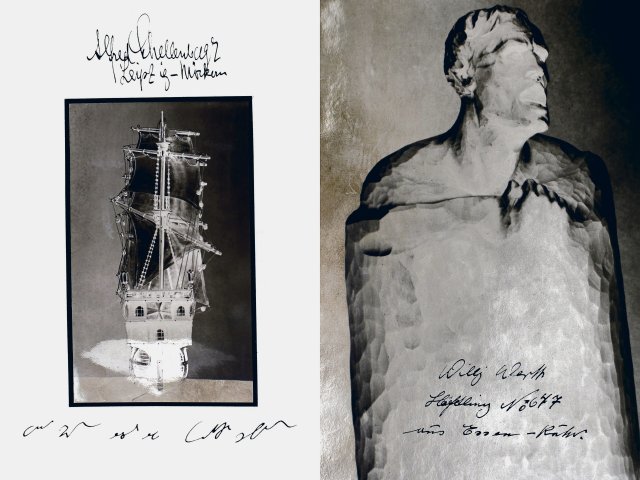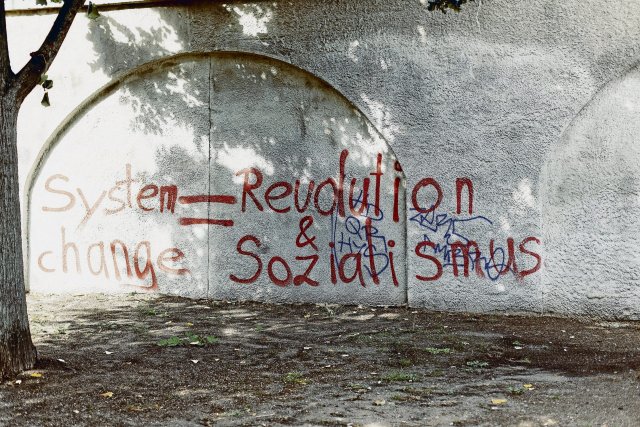- Kultur
- Die Rudolstädter Bühne am Ende des Dreispartentheaters
Goethe & Beckett zum Faust-Endspiel
Aha, können Böswillige sagen, das Stadttheater spielt wieder mal eigene Zukunft: Schluß. Aus. Endspiel - das war's. Sieh nur, die Menge dränget nicht mehr ins Offene; sie beklatscht nur noch, wie Faust mit Beckett verendet. Und einen Kalauer obendrauf: Zum Faustkampf gehören hier drei: der Regisseur hat gleich gegen zwei Dichter gewonnen.
Doch gehen wir mit dem Projekt etwas behutsamer um. ? Axel Vornam, seit mehreren, Jahren Chef desÜudolstädter Schauspiels, hat „Faust I“ und „Endspiel“ von Samuel Beckett zu einer vierstündigen Aufführung vermischt. Nachdem die Faust-Geschichte eingeführt ist, der Zuschauer sich an Goethes Verskraft zu delektieren beginnt, fällt ein gelber Vorhang, vor dem roter Mephisto und schwarzer Faust zum tiefsinnigen Hörspieldialog angetreten sind. Von Beckett sind zwei Figuren geblieben: Hamm im Rollstuhl und Sohn Clov Letzterer mit dem Gedanken spielend (?), den hilflos-blinden Vater zu verlassen. Dieses Gerippe aus dem Beckett-Stück wurde in den leicht reduzierten Faust eingebaut. Immer dann, wenn der Pakt an Höhepunkte kommt, steigen Faust und Mephisto vor dem Vorhang in ihre Endspiel-Rollen Clov und Hamm. Ich war nur mäßig von diesem Sandwich-Theater -Schicht Goethe, Schicht Beckett - begeistert, die versammelten Goethe-Gesellschaften Oberfrankeris und Mittelthüringens hatten möglicherweise noch größere Pro-
bleme: kurz nach Spielbeginn waren rechtschaffene Schnarchtöne zu hören.
Dabei sind nicht wenige Lichtblicke in dieser Inszenierung zu sehen, beginnend mit opulenter Lichtregie und praktikablem Bühnenbild. Rechts und links steile Schrägen, der Boden dazwischen farblich wandelbar und für Auerbachs Keller und Walpurgisnacht - letztere als amerikanische Stehparty.- glei--> chermaßen faszinierend benutzbar. Aüsstätttirigslerter' Hans-Joachim Wolf ist für das Haus wohl ein Glücksfall. Die Kostüme und Masken (Esther Kemter) unterstrichen Vornams Spiel mit faschistoiden Elementen, mit schwarzen Planen, weißen Tüchern und mittlerweile zum guten Ton gehörendem Dosenscheppern. Faust (Rainer Etzenberg), körperlich gut disponiert, Mephisto (Ulf Perthel) sprachlich
exzellent; Gretchen (Nina Kolaczek), eine aufsässige, Faust keineswegs verfallene Göre mit losem Mundwerk, konsequent bis in die Kerkerszene. Schöne Einfälle beim Osterspaziergang und in Auerbachs Keller; des Regisseurs kühler Kopf und sein politischer Kunstverstand - Engel als Schergen, Herrgott als Kanzlist - wurden deutlich. Allerdings sah ich zu oft Konstruktionslinien anstelle vonMen- ? jSchen. Der Dauerton Ironie kann langweilen.
Theater ist ein Nachlaß des bürgerlich-repräsentativen Zeitalters. Sollte also subventioniertes Theater gänzlich neu organisiert werden? In Rudolstadt werden in dieser 201. Spielzeit musikdramatische Werke noch mit eignen Kräften inszeniert; demnäthst soll Eisenach das übernehmen - Rudolstadt in der Wartburg-
stadt dafür Sprechstücke vorführen. Theaterverbund heißt diese Form, in der irrsinnige Kosten, vor allem für repräsentierende Leiter und Stars, Regie führen. Es wäre wohl dämlich, für die Provinz „billiges“ Theater zu fordern, damit „teures“ nur auf landeshauptstädtischen, Provinzbrettern stattfinden kann. Als seien Bewohner von Regierungssitzen intelligenter als andere^Menschen. Eher wäre das Gegenteil beweisbar, denn Regierende sind ja auch Bewohner... Doch was hat das mit dem Rudolstädter Endspiel auf dem Theater zu tun? Ist's das reduzierte Menschenbild, das auf Kosten getrimmte Da-Sein, der unzerstörbare kapitalistische Glaube: Viel Gage - viel Ehr - ist's all das, was die Endzeit bisherigen Theaters aufscheinen läßt?
MATTHIAS BISKUPEK
Als sie in der ersten Reihe der Staatsoper, zwecks Erhöhung auf einem dicken Kissen sitzend, „Aufforderung zum Tanz“ sah, stand für Angela Reinhardt endgültig fest: „Ich werde Tänzerin“ Da sie mit Musikalität und stimmlichen Talenten gesegnet ist, wurde der Wunsch nur gelegentlich von der Überlegung, Sängerin zu werden, verdrängt. Und so ganz hat sie das Stimmbandtraining auch noch nicht aufgegeben. Wer weiß, vielleicht können wir sie auch einmal in einem Musical erleben, dem sie einige Sympathien entgegenbringt. Die Freunde des Balletts werden jedoch froh darüber sein, daß sie dem Tanz treu blieb und sich den oft quälenden Mühen der Ausbildung an der international renommierten Berliner Ballettschule unterzog. „Die Forderungen dort waren hart, aber die von Professor Puttke auf Höchstleistungen orientierte Ausbildung hat sich bewährt, und ich merke an mir selber, daß ich nicht glücklich bin, wenn ich es mal etwas ruhiger angehen lasse. Nach kurzer Zeit fühle ich mich unwohl und lege wieder zu.“
Tänzer müssen in einem Alter ihre Berufsentscheidung treffen, da andere mit Puppen spielen oder als Räuber und Gendarm durch die Gegend tollen. Da kann es später, wenn sich der erhoffte Erfolg nicht einstellt, schnell zu Frustrationen kommen. „Ich habe meine Entscheidung noch keinen Augenblick bereut, unzufrieden bin ich nur, wenn ich nicht genug gefordert werde.“ Das kann man von Tänzern an beinahe allen Opernhäusern hören, denn Ballettabende haben in deren Repertoire noch längst nicht Gleichberechtigung erlangt.
Seit 1983 ist Angela Reinhardt an der Komischen Oper engagiert, 1984 bereits wurde sie Solistin und 19871. Solotänzerin. Seither konnte sich die grazile Mädchenfrau in zahlreichen Partien bewähren. Im Sommer vergangenen Jahres gab sie ihr Rollendebüt in „Romeo und Julia“, in der so erfolgreichen Choreographie Tom Schillings. Ein gro-ßer Erfolg für sie, immerhin trat sie die Nachfolge der berühmten Hannelore Bey, die dieser Rolle schon über viele Jahre unvergeßliches Profil verleiht, an. Und die Ottilie in Schillings Ballett „Wahlver-
wandtschaften“ zählt auch zu einer ihrer liebsten Rollen. Am Sonntag ist sie als verführerische Coppelia in dem gleichnamigen Ballett von Jochen Ulrich zu erleben. Ihr Wunsch ist es, jetzt auch einmal widersprüchliche Frauencharaktere darstellen zu dürfen.
Zahlreiche bei nationalen und internationalen Wettbewerben erworbene Preise sind ein Beweis der Klasse der jungen Tänzerin. Doch nicht nur im Klassischen ist Angela Reinhardt Spitze. Neuem aufgeschlossen, hat sie sich auch mit modernen Tanzstilen (auf ganzer Sohle) angefreundet, deshalb zeitweilig in einer freien Gruppe mitgewirkt. Das kommt ihr in der neuen Inszenierung sicher zugute, denn in der „Coppelia“ von Jochen Ulrich - Musik Leo Delibes - werden durchaus Bezüge zum Heute hergestellt, was sich natürlich auch in der Wahl der tänzerischen Mittel widerspiegelt. „Es war nicht einfach für uns, Break-Dance und Electric-Boogie zu erlernen, aber es hat großen Spaß bereitet.“ Ist es heutzutage, da viele Menschen in einer komplizierten Situation leben, überhaupt angebracht, sich mit den Phantasiegestalten des Mechanikus Dr. Coppelius zu beschäftigen? „Ich glaube schon, denn im übertragenen Sinne zeigen wir durchaus auch heutige Probleme, die Gefahr, daß Maschinen, Computer den Menschen aus vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens verdrängen.“
In der Diskussion um Einsparungen öffentlicher Gelder auch im kulturellen Bereich wurde der Vorschlag unterbreitet, die Ballette der drei Berliner Opernhäuser zu einem zu verknüpfen. „Das mag für einige eine verblüffend einfache Lösung sein. Allerdings wird dabei,, nicht.bedacht, daß die drei Kompanien in vielen Jahren' ihrer Existenz ihre eigenen künstlerischen Stile entwickelten, die nicht so ohne weiteres miteinander zu vermischen sind, will man nicht international anerkannte künstlerische Qualtität leichtfertig momentanen ökonomischen Zwängen opfern. Ich finde es auch nicht besonders verantwortungsbewußt, wenn Politiker von Kunst so reden, als handelte es sich um Luxus.“
GÜNTER GÖRTZ
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.