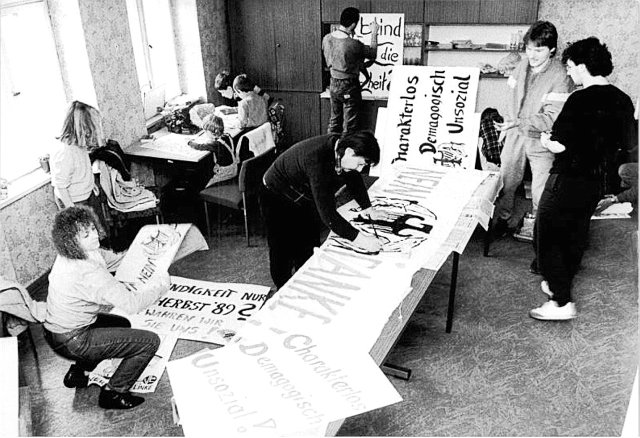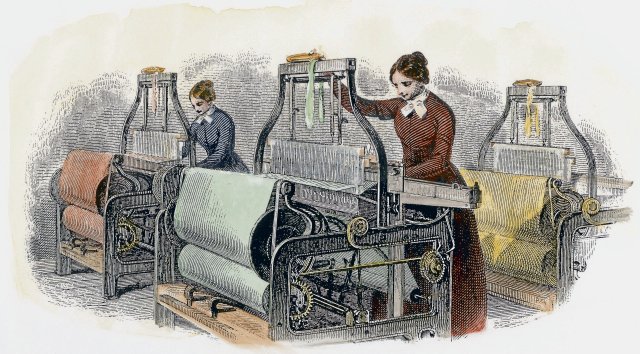- Kultur
- „Fraktur“, ein Band von KURT DRAWERT
Als wollte er etwas sagen. ..
Was macht den Dichter Kurt Drawert aus? Die schlüssigste Erklärung gibt ein Vergleich des Drawertschen Gedichtes Zweite Inventur (1986) mit dem Gedicht Inventur von Günter Eich. Eich, zwei Weltkriege und Desillusionen aller Art als Erfahrungshintergrund benützend, weist in seinem berühmten Gedicht vor, was er noch hat: Dies ist meine Mütze/ dies ist mein Mantel/ ... / mein Teller, mein Becher/ ich hab in das Weißblech/ den Namen geritzt. / Geritzt hier mit diesem/ kostbaren Nagel usw Besitzen ist für das Ich (Eich) eine Elementarerfahrung. Das Gedicht erschreckt durch seine Bestimmtheit und durch sein Geheimnis. Drawert hat es nicht erkannt. Er buchstabierte auf der Oberfläche jener großartigen Verse herum und schrieb ein Widmungsgedicht für Eich. Zweite Inventur listet auf, was den 1956 geborenen Dichter, in der DDR lebend, umgibt: Tisch, Stuhl, Abfälle, Zigarettenschachteln, Notizen, Manuskripte, gebrauchte
Fahrscheine u.v.a. 38 Verse lang Utensilien einer Dichterstube, in der man vergeblich nach jener Elementarerfahrung sucht, die Anlaß für Eich gewesen war, seine durch Geschichte minimierte Existenz mit einem Minimum an Worten auszudrücken. Das Gedicht von Drawert ist dagegen geschwätzig und von einer Nichtigkeit, die das Eich-Gedicht umso bedeutender erscheinen läßt. Zweite Inventur ist eine Simulation und typisch für Kurt Drawerts Literatur.
Der Band Fraktur versammelt Gedichte, Kurzprosa und Essays - die meisten bereits veröffentlicht. Am Ende des Bandes: der detaillierte Lebenslauf des Dichters, verziert mit der Erwähnung von insgesamt 10 Preisen und Stipendien der letzten fünf Jahre. Dieser Ruhm erweckt Erwartung und Mißtrauen. Eine zehnfache Ehrung setzt voraus, daß jemand vielen Leuten zum Gefallen schreibt. Aber Drawert ist kein gefälliger Dichter, bei ihm liegt das Problem tiefer.
Man darf die Drawertschen Texte nicht verstehen wollen. Nur bei wenigen Gedichten und in kurzen Strecken Prosa gelingt einem etwas wie Begreifen. Der Rest ist Raunen. Bleiben wir bei den Gedichten: Man liest sie und ist irgendwie berührt. Man will sie genauer lesen und ist verärgert. Man darf sie nicht genauer lesen, denn dies holt einen aus der Stimmung. Drawerts Stimmungsmache geschieht im flachen Klageton des Zeitgeistes: Ob in den in der DDR oder in den letzten Jahren verfaßten Versen - ein modernes Wehleid macht sich breit. Es gibt sich ernsthaft und allumfassend, ein falsch verstandenes Sinnbild des Deutschen Dichters schlechthin - Drawert zählte sich bereits mit 36 Jahren zu den Großen. Leid und
Von HANS SCHUBERT
Kurt Drawert. Fraktur Lyrik, Prosa, Essay. Reclam Verlag Leipzig. 160 S., brosch., 19 DM.
Klage, Verzagtheit und Magengeschwüre, Sprachstörung und die ach so mörderische DDR-Vergangenheit - das ist freilich preiswürdig! So undurchschaubar die Drawertsche Sprache ist, so durchschaubar sind die routiniert gesetzten Wirkungspunkte. Des Dichters Themen sind hochgesetzt und niedrig genommen: Nichts ist sagbar, die Sprache, die Räume, ja die Welt ist krank, der Dichter leidet seitenweise unter Sprachohnmacht, produziert aber zugleich ein Sprachkonvolut, das selbst den wohlmeinendsten Leser irgendwann vor die Frage stellt: Bin ich nicht intelligent genug, um DAS BUCH zu verstehen?
Drawerts Gedichte sind angesiedelt zwischen Eich, Fried und Krolow Mit dem Unterschied, daß Drawert Nachnutzer eines Lebensgefühles ist, das die o.g. Dichter in den 60er/70er der BRD beschrieben. Die Zertrümmerung der pathetischen Sprache, das Nicht-Nennbare, die Auflösung des Versbegriffes, der Dichtungstraditionen schlechthin das alles ist bei jenen Dichtern durch Lebens- und Literaturerfahrung gewachsen und begründbar. Was da Prinzip ist, ist bei Drawert zufällig: Wenn meine Sprache, meine Gedanken/ einer Verfehlung gleich, abnabeln vom Sinn,/ wortschlierig sich verlieren, versanden... Ein Credo, gewiß.
Aus Drawerts frühen, in der DDR geschriebenen Gedichten spricht kein Schmerz, sondern allenfalls Langeweile und Überdruß an sich selbst. Gewiß, melancholische Selbstironie ist nicht zu übersehen doch das Leben ist nichts besonderes. Warum aber schreibt einer, wenn das (sein) Leben nichts besonderes zu bieten hat? Oder ist DAS gerade das Besondere? Mit nebulöser Unverbindlichkeit, die sehr poetisch klingt in den Gesten des weltdurchschauenden Philosophen, versteht Drawert den Eindruck eines modernen Hölderlin zu erwecken. Wieder ein preisverdächtiger Punkt, denn das Feuilleton sucht nach Hölderlinen, neuen Sprachgenies, vom Regime geknebelt, in den Turm gesperrt, ausgestoßen von der Welt. Drawert weiß, was er schreibt. Er tut nur, als brenne das Genie der Unnennbarkeit in ihm durch. Im Gedicht im Juni/ Juli/ August, 1984 geschrieben, erklärt er: Die Worte gehören mir nicht/ kalt lagen sie unter der Zunge als/ nicht gemachte Erfahrung. So ist es. Oder so: Alltagsabläufe, ganz einfach wie im Leben, werden ungebrochen in Verse gesetzt - fertig ist das Gedicht. Das Nichtige, zeilengebrochen gedruckt, wird doppelt nichtig. Es geht
in Drawerts Gedichten um leere Stühle, Bettwäsche, Wolken, Weingläser und Haarausfall. Aber wer sagte denn, daß es heute irgendwo um mehr geht.
In den Gedichten nach 1991 vollzieht der Autor einen Ortswechsel: ... Meine Freunde im Osten/ verstehe ich/ nicht mehr ... Die Einsicht, wie fremd der arme Poet in deutschen Landen war und ist, kommt plötzlich und mit aller Härte: Nirgendwo bin ich angekommen / Nirgendwo war ich zu Haus. Der Ton ist gefunden, dieses kultivierte Leiden, das nachempfundene große Thema der Deutschen im koketten Schulterschluß mit den Dichtern der Weltliteratur. In einem verquasten Stil, in verworrenen unendlichen Kettensätzen, in Hessescher und Rilkescher Manier, mit viel Wind, Wolken und Träumen, mit Hinweisen auf den Nervenarzt und den Lieben Gott erzeugt der Verfasser Gebilde wie aus poetischen Nebelmaschinen. „Verlorensein in der Welt des Belanglosen“ - 19 -Jahrhundertpathos mit Gegenwartsseinssprengseln suggeriert einen hohen Ton und wird, will man wirklich etwas aus der Literatur erfahren, unfreiwillig komisch: ...ich erwachte zu früh vom Geschrei glücklicher Vögel, stand von meinem Nachtlager auf und ... schaltete den Fernseher ein.
Würde man die Drawertsche Sprache genau untersuchen, käme man auf die kuriosesten Ungenauigkeiten: ...wirjaulten wie frischgeworfene Hunde und geiferten Speichel aufs versiegelte Parkett. Wer jemals frischgeworfene Hunde gesehen hat, weiß, daß sie nicht jaulen, sondern allenfalls piepsen; und wer die Bedeutung von Geifern kennt, weiß, daß Speichel begriffsimmanent ist. Lektorenarbeit. Die Vatergeschichte des Autors könnte interessant sein, wenn sie nicht von dieser rokokohaften Satzkonstruktion überfrachtet wäre. Er gefällt sich in Formulierungen wie Illusionsgeborgenheit oder Objektivität des Denkens verlassen (In „Die Krankheit der Räume“), oder er schreibt Germanistenprosa, an der selbst mein großes Fremdwörterbuch versagt. Bei einem Text wie Kein Ende. Kein Anfang frage ich mich: was will er uns nur mitteilen??? Das kultivierte Gelaber verhindert jede Möglichkeit, Welt, Geschichte und Gegenwart auch nur in geringem Maße erklärbar zu machen.
Freilich, ich weiß: Nicht Aufklärung ist gefragt, sondern Obskurantismus und fatalistische Endzeitphilosophie. Drawert bedient das Geforderte. Das Gefährliche ist nicht, daß es schlechte Texte wären, das Gefährliche ist das Mittelmaß. Kurt Drawert schreibt gekonnt genug, um Eindruck zu machen. Er redet Fraktur, wo ein Ganzes angesagt wäre. Damit ist er im Gespräch.
Christa Kozik ist die Erfinderin des dritten Auges in der Kinderliteratur der DDR, jenes Organs, mit dem man nach innen sehen kann, ins Wesen der Menschen und Dinge. Da sie es selbst besitzt, hat sie immer wunderschöne Geschichten zu erzählen gewußt. Auch die vom verzauberten Einbrecher, kürzlich erschienen in der Reihe Bücherkönig bei LeiV, ist eine echte Kozik-Geschichte mit hintergründigem Witz und doch voller Traurigkeit der Autorin, die daran leidet, daß Bücher im ehemaligen Leseland so geringgeschätzt werden. Vielleicht darf man schon sagen, wurden, denn Wiederbesinnung ist deutlich spürbar
Bücherwurm Christoph wächst ohne Fernseher auf und wird darum in der Schule ausgelacht. Er weiß nicht, wer Batman ist, kennt nicht den
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.