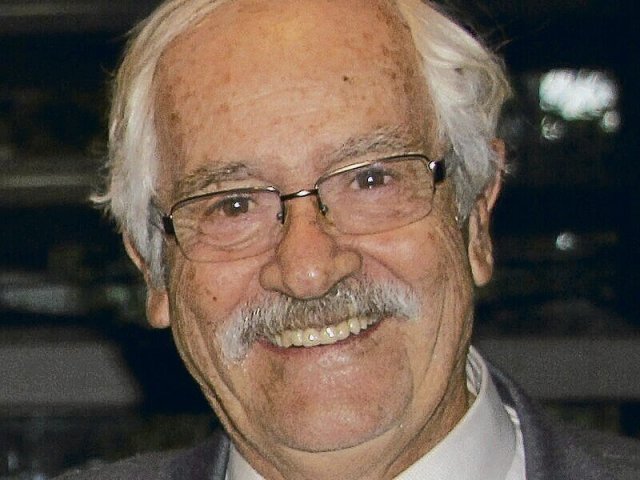Spielräume für Marktsteuerung
Alle Verfechter einer Demokratisierung der Wirtschaft wissen nicht nur um die Komplexität und Vernetztheit der gesellschaftlichen Reformen. Es besteht auch kein Zweifel an der Obstruktionspolitik der Kapitaleigentümer. Kapitalflucht kann bekämpft werden, und auch gegen den Investitionsstreik müssen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Ära der Investitionsanreize und Steuervorteile für Kapitalgeber muß beendet werden. Durch Entwicklungsgesellschaften, Risikofonds, Demokratisierung des Bankensystems und Ausbau der Globalsteuerung könnten die Versuche zur Verteidigung der Kapitalherrschaft unterlaufen werden.
In der Vergangenheit sind die meisten Versuche der Demokratisierung auf die Mikroebene der Unternehmen begrenzt gewesen. Es käme jedoch gerade darauf an, den Zusammenhang einer Änderung in den Verteilungsverhältnissen mit neuen Formen der Globalsteuerung durch Finanzund Fiskalpolitik einzulösen. Hier geht es nicht um eine möglichst vollständige Skizze der Strategie der Demokratisierung; es geht vielmehr darum, den inneren Zusammenhang zwischen mikroökonomischer Unternehmensverfassung und makroökonomischer Reform in den Verteilungsverhältnissen und Steuerungspotentialen zu verdeutlichen.
Den Protagonisten der Wirtschaftsdemokratie ist klar, daß die angestrebte Reform letztlich auf eine Revolutionierung der Gesellschaftsformation hinauslaufen wird: „Eine Wirt-
schaftsordnung ohne Massenarbeitslosigkeit, die es jedem Gesunden ermöglicht, sich seinen Lebensunterhalt durch eigene Leistung zu verdienen, und sicherstellt, daß das Bruttosozialprodukt gerecht entsprechend den erbrachten Leistungen jedes einzelnen verteilt wird, macht viele sozialstaatliche Ausgleichsmechanismen der sozialen Marktwirtschaft überflüssig. Wenn die Massenarbeitslosigkeit abnimmt, wird auch das durch sie ausgelöste Massenelend kleiner werden. Wenn die Gegensätze zwischen arm und reich geringer werden, wird sich die gesamte Wirtschaft wieder mehr auf die Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse konzentrieren, statt auf die Luxusbedürfnisse der Reichen... Die Hilfe des Staates kann sich auf diejenigen konzentrieren, deren eigene Leistungsfähigkeit durch Behinderung, Krankheit oder Alter eingeschränkt ist.“ (Stein, S.155) Auch die Struktur der Weltwirtschaft würde sich zwangsläufig verändern und neue Chancen einer Entwicklungspolitik eröffnen.
Der Grundgedanke dieser Demokratisierungsstrategie besteht darin, daß die Gleichsetzung von Markt und kapitalistischer Wirtschaftsordnung nicht aufrecht erhalten werden kann. Es ist möglich und lohnenswert, die kapitalorientierte Eigentums- und Rechtsordnung zu verändern, weil damit zwar nicht die Marktsteuerung verschwindet, aber sämtliche Aspekte des Wirtschaftens eine veränderte Gestalt erhalten können. „Die Marktsteuerung ist im allgemeinen jeder Wirtschaftssteuerung durch zentrale Planung weit überlegen. Auch sie weist jedoch eine Reihe von Mängeln auf. Diese gehen aber nicht auf das Marktprinzip zurück, sondern auf die Rahmenbedingungen, die unsere kapitalorientierte Wirtschaftsordnung den Markten vorgibt.“
Im Grunde kommt man sowohl bei einer Auseinandersetzung mit den Grundmängeln der kapitalistischen Wirtschaftsordnung als auch bei der kritischen Betrachtung der zentralen Planwirtschaften immer zum gleichen Schlüsselproblem: Ist es möglich, den Wettbewerb von demokratisierten Unternehmen über Märkte auszunutzen? Und kann, wenn der bislang nicht realisierte Anspruch einer zentralstaatlichen Planung zugunsten wirksamer Steuerungsmethoden aufgegeben wird, eine sozial und ökologisch verträglichere Ökonomie erreicht werden?
Wer diese Fragen verneint und für einen erneuten Sozialismusversuch auf planwirtschaftlicher Grundlage eintritt, müßte die Chancen aufzeigen, wie die bekannten ökonomischen und politischen Grundmängel vermieden werden können. Umgekehrt bleibt auch bei einer positiven Antwort und bei aller Plausibilität der Überlegungen für eine Wirtschaftsdemokratie offen, wie eine solche qualitative Veränderung unter den gegenwärtigen- politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen durchgesetzt werden kann.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.