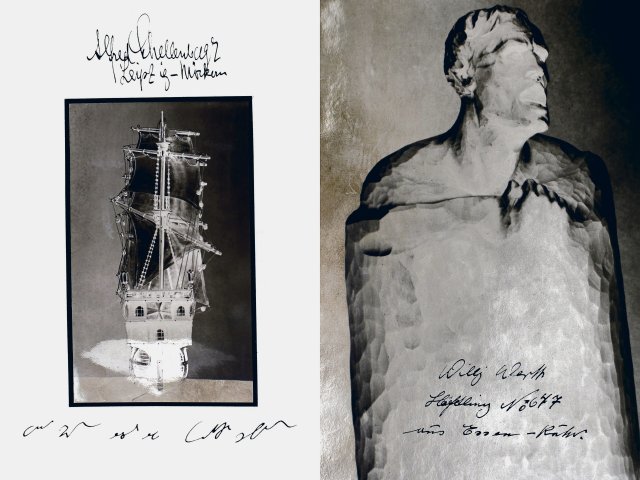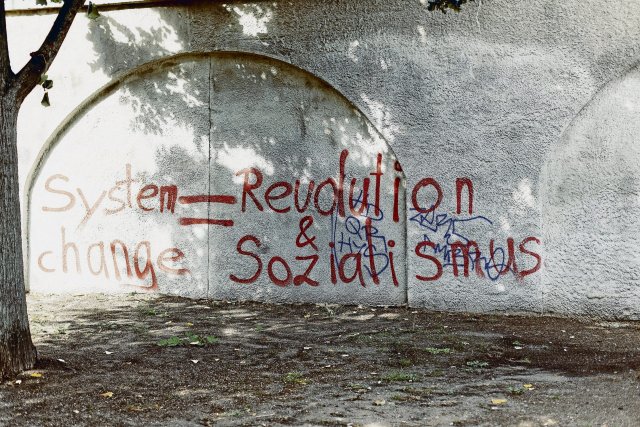Groß und edel muss es sein
Festtage der Staatsoper Berlin: Pollini mit Sciarrino und Beethoven, Barenboim mit Verdis »Requiem«
Die Festtage der Staatsoper, am Montag gingen sie nach zehn Tagen zu Ende, sind wahrlich Großereignis. In erster Linie für Berlin natürlich, jedoch ausstrahlend auf das gesamte Bundesgebiet, ja des deutschsprachigen Raums und noch weiter. Zur Stelle ist jährlich ein internationales Publikum. Das hat viel Geld in der Tasche, die Karten sind sauteuer. Es pendelt zwischen Philharmonie und Schillertheater. Wie gewöhnlich: Die Programmanlage trägt großbürgerlichen Charakter. Das Beste, Größte, natürlich zugleich »Edelste«, Teuerste, eben Großbürgerliche muss es sein. Geladen zum Auftritt sind - nach eigener Definition - ausschließlich weltweit hoch geschätzte Interpreten und Klangkörper. Sie liefern schlechthin Außerordentliches. Neue Musik findet dort durchaus statt, aber klar dosiert, minimiert.
Die Attraktion des Ganzen diesmal: Wagners »Ring des Nibelungen«. Derjenige, welcher ihn besucht hat, musste rund gerechnet vier mal fünf Stunden ausharren mit halbstündigen Pausen dazwischen, wo getrunken und gescherzt und der sprengende Gehalt des »Ring« vergessen scheint. Otto Normalverbraucher hat dort nichts zu suchen. Bekanntlich wächst die kulturelle Kluft, wenn auch in anderer Art, mindestens so wie die zwischen arm und reich.
Überraschend im großen Saal der Philharmonie die Kombination von Teil 10 bis 12 aus dem Zyklus »Carnaval« von Salvatore Sciarrino, Jg. 1947, mit späten Klaviersonaten Beethovens, gespielt von Maurizio Pollini. Ersteres aufgeführt mit dem Klangforum Wien und den Neuen Vocalsolisten Stuttgart unter Tito Ceccherini.
Für »Carnaval«, der Titel geht auf das bekannte Schumann'sche Klavierwerk zurück, muss, so glaubt der Schreiber, der Hörer prädisponiert sein. Die Musik ist bewegungsarm und trotzdem klanglich interessant anzuhören. Es bedarf höchster Konzentration, der Komposition mit fünfstimmigem Chor, Streichern, Bläsern, Klavier, Schlagzeug abzugewinnen, was ihre Wesensmerkmale ausmachen: Mal schleicht sie, wirkt, als stehe, verharre sie. Wenige Male setzt sich Erregung, Heftigkeit durch. Zumeist perlen die Klänge wie das Wasser con gas in Ambassador-Plasteflaschen.
Die drei Teile dauern 45 Minuten. Der ausgedehnte Mittelteil »Räume des Regens« ist rein instrumental und der am schönsten geformte, lebendigste Teil. Der Hörer braucht Geduld, über die vielen wohlgesetzten und ins Uferlose gedehnten Pausen hinwegzukommen. Obendrein ist das perfekt umgesetzte Werk mit textlich-vokalen »Geheimnissen« beschwert, was die Perzeption nicht leichter macht.
Maurizio Pollini bestritt danach die späten Sonaten Beethovens, des Wiener Meisters (op. 109 bis 111). Dass er gesundheitlich angeschlagen ist, konnten seine Wiedergaben nicht immer verbergen. Das Tempo von schnellen Sätzen machte ihm merklich zu schaffen. Die langsamen Sätze hob er über die gewöhnliche Erwartung hinweg. Unheimlich ihre Traurigkeit, ihr erfülltes Singen, das die Seele angreift. Pollini ist kein Showman. Er geht zum Flügel, absolviert sein Pensum, verneigt sich, geht wieder. Das ist kein Undank gegenüber dem Publikum, wohl aber die Haltung: Ich hab meinen Teil abgeliefert, nun gehe ich, schreite zum Nächsten.
Schließlich: gewaltig, einzigartig - diese Vokabeln seien gewählt, weil sie zutreffen - die Aufführung des Aufruhr stiftenden, sämtliche Geister der Vernunft und Unvernunft aufwirbelnden Verdi-Requiems in der voll besetzten Philharmonie. Das gibt es ganz selten: Es musizierten und sangen die Klangkörper der Mailänder Scala unter Daniel Barenboim. Von seltener Strahlkraft die Stimmen des Solistenquartetts. Sie übertönten Chor und Orchester noch im gewaltigen »Dies Irae«, als wären sie selber großer Chor. Sicher wird es davon bald eine CD-Aufnahme geben. Jeder sollte sie anhören.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.