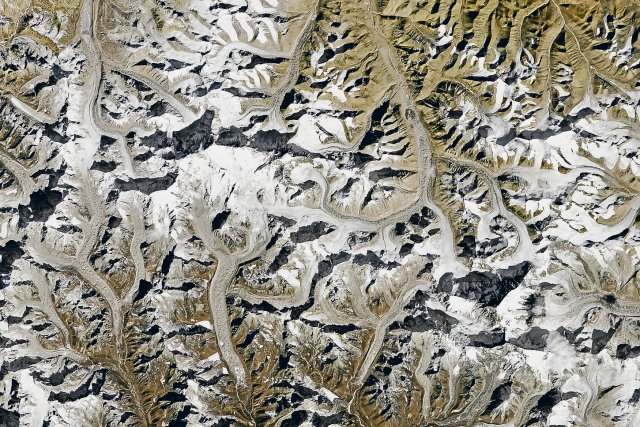Mehr Konkurrenz, mehr Stress
Die Bologna-Reform hat das deutsche Hochschulsystem grundlegend verändert
nd: Sie haben die Veränderung des Studienangebots an Universitäten und Fachhochschulen durch die Bologna-Reform unter die Lupe genommen. Was genau haben Sie untersucht?
Martin Winter: Untersucht haben wir das anhand von 20 Universitäten und Fachhochschulen in vier Bundesländern. Dabei haben wir uns die jeweils angebotenen Studiengänge zu zwei Zeitpunkten - 2000 und 2011 - angesehen und miteinander verglichen.
Welche Unterschiede haben sie festgestellt?
Winter: Insgesamt bestehen auch nach der Bologna-Reform deutliche Unterschiede zwischen dem Studienangebot der Universitäten und der Fachhochschulen. So gibt es an allen untersuchten Universitäten mehr Master- als Bachelor-Studiengänge. Die Fachhochschulen konzentrieren sich im Gegensatz dazu stärker auf den grundständigen Studienbereich und bieten mehr Bachelor- als Master-Studiengänge an. Innerhalb der Gruppe der Fachhochschulen wie auch innerhalb der Gruppe der Universitäten variieren allerdings die Anteile. Hier fand also durchaus ein gewisser Differenzierungsprozess zwischen den einzelnen Standorten statt. Unterschiede zwischen beiden Hochschularten konnten wir auch bei der Deklaration von forschungs- und anwendungsorientierten Studiengängen feststellen. Universitäten bieten vorrangig forschungsorientierte Masterprogramme an, während Fachhochschulen stärker auf anwendungsorientierte sowie weiterbildende Master-Studiengänge setzen.
Zu einer Annäherung zwischen den Universitäten und den Fachhochschulen ist es also nicht gekommen?
Winter: Genau, insgesamt scheint die Bologna-Reform nicht die - je nach Perspektive erhoffte bzw. befürchtete - Annäherung von Fachhochschulen und Universitäten gebracht zu haben. Eher scheint es so zu sein, dass insbesondere die Universitäten die Umstellung auf die neuen Studienabschlüsse dazu genutzt haben, sich als Universitäten zu profilieren und sich auf diese Weise von den Fachhochschulen abzugrenzen. Diese Interpretation legen die Daten nahe. Inwieweit dies tatsächlich eine bewusste Strategie der Hochschulen war, wäre genauer zu untersuchen.
Und die Veränderungen in den Studiengängen selbst - wie viel »Neuerung«, wie viel »Reform« ist hier festzustellen?
Annika Rathmann: Eigentlich verfügen die Hochschulen über mehr inhaltliche Spielräume ihre Studiengänge zu gestalten, als dies noch vor der Bologna-Reform der Fall war. Daher haben wir uns genauer angeschaut, inwieweit die verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen diese Ausgestaltungsmöglichkeiten auch tatsächlich genutzt haben. An den Fachhochschulen ist eine deutlich höhere »Reformintensität« als an Universitäten festzustellen, das heißt, es hat dort größere Veränderungen im Studienangebot gegeben.
Worauf führen Sie das zurück?
Rathmann: Zurückzuführen ist dieser Unterschied auch auf den hohen Anteil an sprach- und kulturwissenschaftlichen Studiengängen an Universitäten. Gerade bei Studiengängen dieser Fächergruppe herrscht oftmals Kontinuität. Insgesamt wurden die Gestaltungsmöglichkeiten von den Fächergruppen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Besonders im Bereich der Ingenieurwissenschaften unterlag das Studienangebot starken Veränderungen - das ist auch deshalb erstaunlich, weil dort immer wieder die Diskussion »Rückkehr zum alten Diplom« geführt wird. Innerhalb der Fächergruppe »Mathematik und Naturwissenschaften« gibt es demgegenüber deutlich weniger Variationen.
Und wie haben sich die Modalitäten für die Studienplatzvergabe verändert?
Rathmann: Die zentrale Frage hinsichtlich der Studienplatzvergabe war, ob die zulassungsbeschränkten Studiengänge mehr oder weniger geworden sind. Insgesamt zeichnet sich ab, dass der Zugang zum Studium restriktiver geworden ist. Zwar gibt es auch noch im Wintersemester 2011/2012 mehr zulassungsfreie als zulassungsbeschränkte Studiengänge. Im Vergleich zum Wintersemester 2000/2001 ist der Anteil dieser zulassungsfreien jedoch deutlich zurückgegangen. Sowohl 2000 als auch 2011 war dabei an den Fachhochschulen ein größerer Teil des Studienangebots mit Zulassungsbeschränkungen belegt als an den Universitäten. Durch den starken Anstieg des Anteils örtlich zulassungsbeschränkter Studiengänge an den Universitäten haben sich die beiden Hochschularten jedoch inzwischen etwas angenähert.
In der Zusammenfassung Ihrer Studie sprechen Sie davon, dass auch immer mehr eigentlich »zulassungsfreie« Studiengänge zunehmend nicht mehr frei zugänglich sind. Wie muss man sich das vorstellen?
Winter: Wir sind der Frage nachgegangen, welche Voraussetzungen in den einzelnen Studiengängen erfüllt sein müssen, um einen Studienplatz zu bekommen. Dabei mussten wir feststellen, dass der Zugang zum Studium nicht nur aus Kapazitätsgründen, sprich: zu wenige Studienplätze für zu viele Studienbewerberinnen und -bewerber, reglementiert wird. Es gibt zudem eine beträchtliche Anzahl von Studiengängen, deren Zulassung von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht werden - auch wenn der Studiengang nicht droht, »überfüllt« zu werden, und er folglich auch keinen Numerus clausus aufweist. Dies gilt nicht nur für den Master-, sondern auch für den Bachelor-Bereich. Für diese »eigentlich« zulassungsfreien Studiengänge werden seitens der Hochschulen spezifische Kriterien definiert, die bereits vor Studienaufnahme von den Bewerberinnen und Bewerbern erfüllt sein müssen.
Rathmann: Konkret heißt das: Im Wintersemester 2011/2012 war knapp die Hälfte des grundständigen Studienangebotes als zulassungsfrei ausgewiesen. Tatsächlich »hürdenfrei« war dabei jedoch nur rund ein Viertel der grundständigen Studiengänge der ersten Studienphase.
Wie sind Ihrer Auffassung nach die festgestellten Veränderungen in die zu erwartende weitere Entwicklung des bundesdeutschen Studiensystems einzuordnen?
Winter: Die Entwicklung des Studiensystems ist offenbar von einem zunehmenden Wettbewerb gekennzeichnet. Dieser hat zwei Seiten: einerseits die Konkurrenz der Abiturientinnen und Abiturienten um Studienplätze und andererseits der zunehmende Wettbewerb der Hochschulen um gute Studierende. Ein verstärkter Wettbewerb um Studierende führt wiederum dazu, dass die Hochschulen immer mehr den Marketinggedanken als eine Art »Unternehmens- bzw. Hochschulführungsphilosophie« übernehmen und sich entsprechend ausrichten.
Entwicklungen im deutschen Studiensystem. Analysen zu Studienangebot, Studienplatzvergabe, Studienkapazität, Studienwerbung und Marketing, HoF-Arbeitsbericht 7/2012; www.hof.uni-halle.de
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.