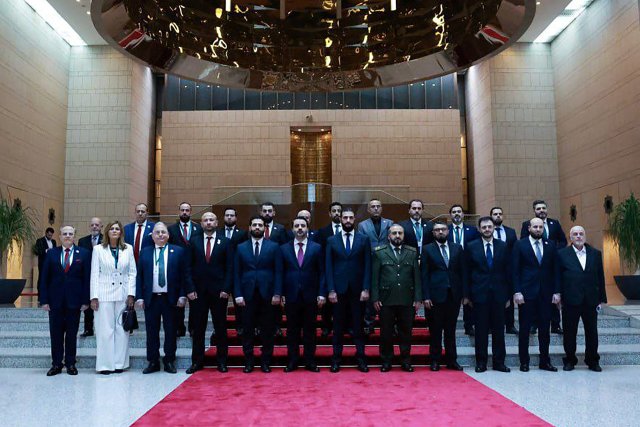Huffington statt Washington
Nach spektakulären Zeitungsverkäufen wird in den USA erneut der Abgesang auf die »Holzmedien« angestimmt
Die US-Zeitungsbranche steht unter Schock. Zwar ist es ein paar Tage her, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos die »Washington Post« gekauft hat, doch ist dieser Angriff der virtuellen Welt auf die »Holzmedien« noch nicht verdaut. Die zweitwichtigste Zeitung des Landes ist in die Hände eines Internetmilliardärs gewandert.
Optimisten hoffen, dass Bezos den seriösen Journalismus schützen möchte. Andere glauben, dass Bezos die Marke ausschlachten wird. »Bezos sieht die Post als (...) einen vertikalen Content-Träger«, schrieb der New Yorker Medienanalyst Michael Wolff. Die Vollzeitung würde zum digitalen Anbieter politischer Analysen reduziert.
Die US-Zeitungen kämpfen seit Jahren um das Überleben. Meilensteine auf diesem Weg gab es viele - das Ende des »Seattle Post Intelligencer«, der Bankrott der »Tribune«-Gruppe, der Verkauf des »Wall Street Journal«. Der Deal um die »Post« hat eine neue Qualität. Die Transaktion führt vor Augen, dass die Zeitung als Geschäftsmodell ausgedient hat. »Das ist ein definitives Ende«, schreibt James Fallows im Intellektuellenmagazin »Atlantic«.
Das Schockierende: Das Herzstück des Imperiums der Verlegerfamilie Graham erzielte nur einen Spottpreis. Die Grahams galten als Verleger alter Schule. Doch zuletzt konnte die Erbin Katharine Weymouth keine Zukunft mehr im seriösen Journalismus mehr erkennen. »Die Grahams haben sich mit einem gerüttelt Maß an Abscheu von dem abgewandt, was aus ihrem Vermächtnis geworden ist«, schreibt Michael Wolff.
Die 250 Millionen Dollar, die Bezos bezahlt hat, waren ein Dumpingpreis. Das Wall Street Journal, das die Verlegerfamilie Bancroft vor sechs Jahren an Rupert Murdoch abgegeben hat, brachte noch das Zwanzigfache. Der Handel passt ins Bild: Fast gleichzeitig stieß die »New York Times« den »Boston Globe« für 70 Millionen Dollar an den Besitzer der dortigen Baseballmannschaft »Red Sox« ab. 1993 hatte man selbst noch 1,1 Milliarden für den Globe bezahlt.
Die Motive für den Kauf von Zeitungen sind unterschiedlich. Der Investor Warren Buffet, der eine Reihe von Zeitungen im Mittleren Westen erworben hat, will anscheinend tatsächlich die Freiheit der Presse retten. Anderenorts, wie etwa in San Diego, kaufen Geschäftsleute, um schamlos ihre Interessen zu befördern. Andere, wie etwa der Kaugummi-Erbe Wrigley in Chicago, legen sich Zeitungen aus Eitelkeit zu.
Dass sich damit kein Geld mehr verdienen lässt, musste zuletzt der Chicagoer Unternehmer Sam Zell feststellen, der 2007 die Tribune Company, mit den Traditionstiteln »Chicago Tribune«, »Baltimore Sun« und »Los Angeles Times« für acht Milliarden Dollar kaufte: 2011 war er mit 13 Milliarden Schulden Bankrott. Die neu strukturierte Tribune Company hat nun ihre Printunternehmungen von den Radio- und Fernsehabteilungen abgespalten - wie die News Corp. von Rupert Murdoch.
Dass der größte reine Online-Anbieter, die »Huffington Post«, ebenfalls stagniert, ist ein schwacher Trost. Die Huffington Post legt noch immer rund 20 Prozent an Klickzahlen pro Monat zu, hat jedoch zu rasch expandiert, um Profite abzuwerfen. Trotzdem hält der Medienkritiker David Carr die Huffington Post für die »rasanteste Marke in der Mediengeschichte.«
Gegenüber der Tatsache, dass das Geschäftsmodell der Huffington Post darauf basiert, Inhalte anderer Medien zu kidnappen und ihren Autoren wenig bis gar nichts zu bezahlen, hat Carr unterdessen resigniert. »Ich beginne zu verstehen, dass es völlig gleichgültig ist, was ich für richtig oder falsch halte, was ich für rechtschaffenen Journalismus halte und was nicht. Dem Markt ist das völlig egal.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.