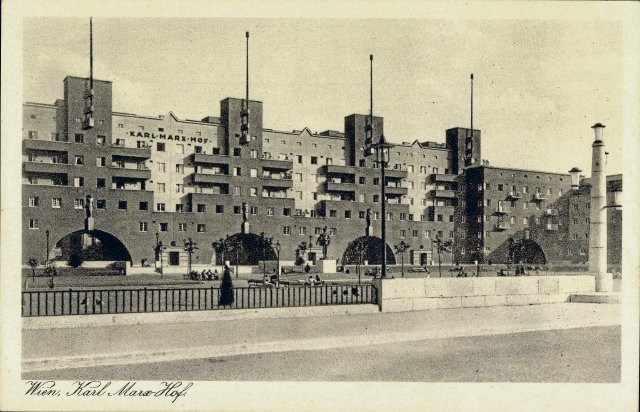Großwindräder starteten mit Pannen
Testanlage »Growian« ging vor 30 Jahren in Betrieb. Von Sebastian Bronst
Ein Rotor mit einem Durchmesser von mehr als hundert Metern, ein Maschinenhaus von 340 Tonnen Gewicht: Die Ausmaße von »Growian« waren gewaltig. Die riesige Versuchs-Windkraftanlage im schleswig-holsteinischen Kaiser-Wilhelm-Koog sollte ein Demonstrationsprojekt werden für alternative Möglichkeiten der Stromerzeugung und die Kompetenz der deutschen Industrie. Doch der vor 30 Jahren offiziell gestartete Großversuch von Bundesforschungsministerium und Großkonzernen scheiterte grandios. Zum Abgesang auf die Windkraft insgesamt aber wurde er nicht. Die Zukunft gehörte fürs erste deutlich kleineren Anlagen.
Anfang der 1980er Jahre aber waren die Verantwortlichen von ihrer Idee noch überzeugt. Die damalige rot-gelbe Regierung in Bonn wischte alle Zweifel an dem Projekt beiseite. »Mit dem Projekt Growian wird zwar technisches Neuland betreten, ein ungerechtfertigt hohes technisches Risiko ist damit aber nicht verbunden«, erklärte das Bundesforschungsministerium während der Vorbereitungsphase Anfang 1982 in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Union.
Damals galten Wind und Sonne zumindest für kurze Zeit schon einmal als rettender Ausweg. Die Ölkrisen der 1970er Jahre hatten die Industrieländer erschüttert und lösten hektische Versuche aus, die riskante Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Energieimporten zu reduzieren. Der große Gewinner der Debatten war die Atomkraft. Doch das Bundesforschungsministerium wollte auch die Chancen der Windenergienutzung ausloten.
Das Ergebnis dieser Bemühungen war die am 17. Oktober 1983 in dem Koog an der Nordseeküste bei Brunsbüttel in Betrieb genommene »Große Windenergieanlage«, kurz »Growian«. Realisiert wurde der Gigant, der es auf eine Leistung von drei Megawatt bringen sollte, von führenden Konzernen. Hauptkonstrukteur war MAN, als Betreiber für das Projekt fungierten die Stromversorger RWE, HEW und Schleswag.
In Deutschland lagen bis dahin nur Erfahrungen mit Rotoren von etwas über 30 Metern Durchmesser vor. Windkraftpionier Dänemark setzte auf das Konzept zahlreicher kleiner, aber verlässlicher Turbinen, die in Gruppen oder Parks gebündelt wurden. Kritiker geißelten denn auch die »Projektgigantomanie« der Bundesregierung.
Tatsächlich wurde »Growian« ein Reinfall. Die Materialien waren den gewaltigen Kräften, die auf die Riesenanlage wirkten, nicht gewachsen. Bauteile brachen, der Rotor stand meist still. »Die Aufgaben waren nach dem damaligen Kenntnisstand effektiv unlösbar. So als hätte man Otto Lilienthal nach seinen ersten Flugversuchen mit dem Bau eines Überschalljets beauftragt«, kritisierte »Die Zeit« 1985. In jenem Jahr fiel die Entscheidung, »Growian« stillzulegen und abzuwracken.
Im Windschatten des abgeschalteten »Growian« öffneten Schleswag und HEW, das Land Schleswig-Holstein und umliegende Kommunen 1987 den ersten Forschungs-Windpark in Deutschland. In ihm erprobten sie rund 30 kleinere Anlagen mit Rotordurchmessern von zunächst nur zehn bis 15 Metern. Dieser »Windenergiepark Westküste« nahe des alten »Growian«-Fundaments existiert bis heute und gilt als eine Keimzelle der kommerziellen Windkraftnutzung in Deutschland.
Großanlagen wie »Growian« wurden erst in den vergangenen Jahren wirklich marktreif. AFP
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.