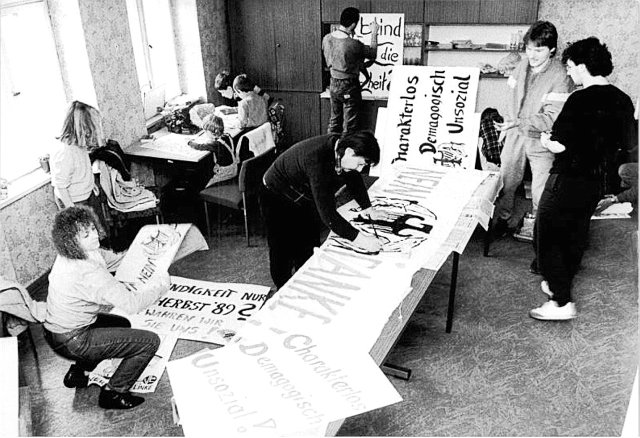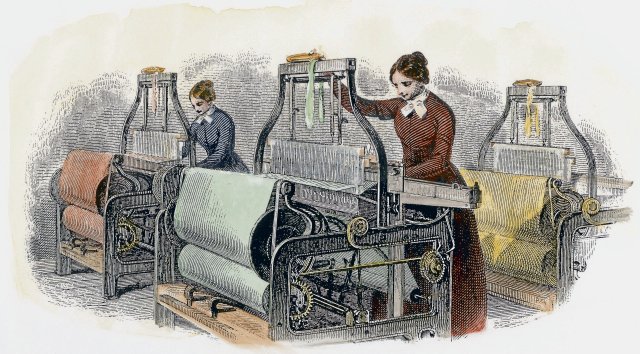Fanfaren für den Untergang
Arte zeigt mit »14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs« die globale Perspektive der Barbarei
Karl Kasser hat ein schlichtes Ziel: Er will nicht sterben. Der Krieg, das Töten - es ist nicht die Sache des einfachen Bauernsohnes. Er will daheim im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn das Feld bestellen, etwas sinnvolles, produktives tun und nicht auf die großen Schlachtfelder ziehen, von denen die Generäle sagen, man siege entweder glorreich gegen den Feind oder sterbe als heroischer Soldat. Kasser will nicht in diesen Krieg, der vor allem vom Bürgertum mit jubelnden Fanfarengesängen begrüßt wird. Er ist nicht wie der Schriftsteller Ernst Jünger, der sich schon am ersten Tag freiwillig meldet, um für das Deutsche Reich und den Kaiser zu kämpfen. Der Krieg, das Soldatsein - so beschreibt es das achtteilige Arte Dokudrama »14 Tagebücher des Ersten Weltkrieges« ist für Jünger von Anfang an ein Abenteuer, um aus dem beengenden Alltag auszubrechen.
Während seine gefühlskalten, im Angesicht der Barbarei der Völker zudem schockierender Weise extrem sachlich niedergeschriebenen Erinnerungen später besonders in stramm nationalistischen Kreisen ihre Leserschaft finden, kennt niemand die Kriegstagebücher eines Karl Kasser, der Russin Marina Yurlova oder der zu Kriegsausbruch erst 12-jährigen Elfriede Kuhr. Wie der Titel bereits ahnen lässt, erzählt das Dokudrama die Geschichte des Ersten Weltkrieges nicht anhand von Schlachtverläufen sondern aus den unterschiedlichen Blickwinkeln verschiedenster Europäer, die sich 1914 noch längst nicht als solche begreifen und ganz im Gegenteil oft separatistischen Bestrebungen nacheifern.
Für Österreich-Ungarn dient die Kriegserklärung am 28. Juli 1914 gegen Serbien deshalb auch dazu, das eigene auseinander strebende Reich mit Gewehr, Granaten und Marschbefehl auf brutalste Art zu einen, selbst wenn dies bedeutet, dass Serben unter dem österreichisch-ungarischen Banner auf ihre Landsleute schießen mussten.
Regisseur Jan Peter inszeniert den Ersten Weltkrieg in einer spätestens seit Guido Knopp bekannten Mischung aus Spielszenen, historischen Aufnahmen und Fakten. Peter erhebt sich allerdings nicht zur urteilenden Instanz, wertet die Lebensläufe der Protagonisten nicht und was noch viel wichtiger ist, er lässt die Historiker und offiziellen Chronisten außen vor. Die dürfen in Vertretung durch Professor Oliver Janz von der Freien Universität Berlin die Produktion zwar kritisch begleiten, bleiben aber ansonsten hinter der Kamera.
Stattdessen konzentriert sich das Dokudrama auf die Lebenswirklichkeit der 14 Tagebuch Schreibenden. Die sind - und hier zeigt sich der entscheidende Unterschied zur Knoppschen Erzählstrategie - authentische Stellvertreter ihrer Zeit und eben keine Figuren aus dem Kuriositätenkabinett Aufarbeitung der Vergangenheit. Bauernsöhne wie einen Karl Kasser gab es Anfang des 20. Jahrhunderts Tausende - ebenso wie eine Elfriede Kuhr. Deren Auftreten verstört zu Anfang, da das Mädchen dem Zuschauer vor Augen führt, wie stark selbst Kinder an den Krieg als wahrhaftige Notwendigkeit glaubten. Es gruselt einen, wenn ein junger Mensch als Reaktion auf das sich immer weiter nähernde Granatenfeuer der zaristischen Armee mit einem blinden Vertrauen auf den deutschen Kaiser antwortet. Der Krieg riss eine ganze Gesellschaft mit sich, anstatt dass sich diese vor dem millionenfachen Tode fürchtete. Es bedurfte erst des persönlichen Verlustes, damit Menschen wie die Künstlerin Käthe Kollwitz den Pazifismus für sich entdeckten. Diese Verluste, die schon bald aufziehenden Ängste und Zweifel an allen Fronten und in der Heimat, zeigt »14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs« schonungslos.
Besonders in den ersten Minuten wirkt die immer wieder auftretende Ansprache des Zuschauers durch Protagonisten unfreiwillig irritierend, da die Handelnden für einen Moment aus ihrem Erleben gerissen werden, das sich ansonsten - so verspricht es Regisseur Jan Peter - möglichst originalgetreu an die Tagebuchaufzeichnungen hält.
Die ersten beiden Teile von »14 Tagebücher« am Di., 20.15 auf Arte.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.