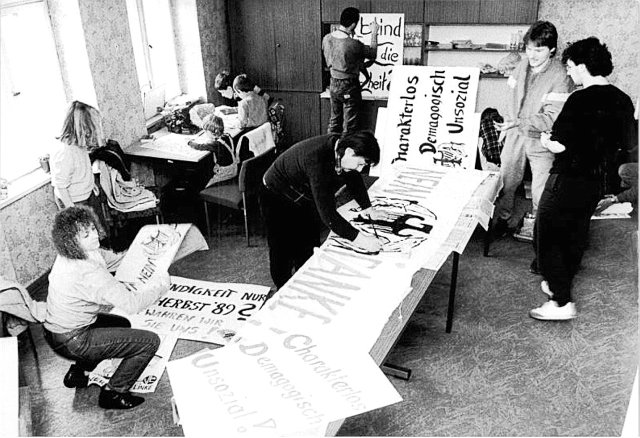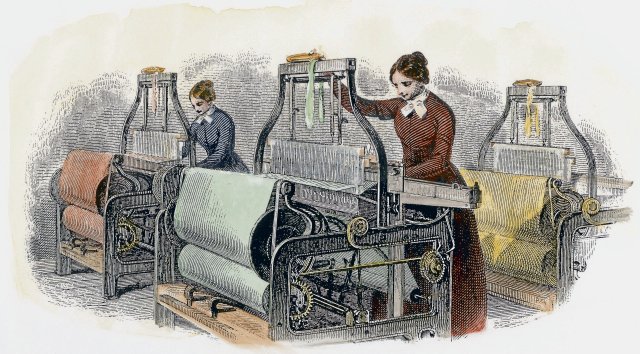Patmos - Dem Himmel ein Stück näher
Werner Liersch
Über den weißen Häusern des Inselhauptstädtchens Chóra strebt das tausendjährige Johanneskloster in das Blau des Himmels. Wie eine Gralsburg thront es da oben, die dunklen Mauern weißzinnengehöht, fast fensterlos, geheimnisvoll in die Bewegung des Lichts getaucht. Seine Bibliothek ist ein Tresor der Menscheitsgeschichte. Die älteste Handschrift ist ein Evangelienfragment aus dem 6. Jahrhundert. Das Johanneskloster beherbergt zehn Kapellen und auf den bescheidenen 34 Quadratkilometern der Insel sind nicht weniger als über vierhundert Kirchen und Kapellen zu treffen. Schlichte Bauten mit irdischem Hintersinn. Die griechisch-orthodoxe Kirche setzt der Anrufung des Himmels gewisse Grenzen. Nur jeweils eine Messe darf am Tag in einer Kapelle gelesen werden. Vierhundert sind ein geistreicher geistlicher Einfall. Patmos hat den Ruf, das Jerusalem der griechisch-orthodoxen Kirche zu sein.
Auf Patmos ist man dem Ende ein Stück näher. Nach der Überlieferung offenbarte in der Felshöhle unterhalb des Inselklosters eine göttliche Stimme dem Evangelisten Johannes das Weltenende. Die Spiritualität der Insel ist vollkommen. Kein Himmel ohne sein Gegenstück. »Ich, Johannes, war auf der Insel, die da heißt Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi. Ich war im Geist am Tage des Herrn entrückt und hörte hinter mir eine große Stimme wie eine Posaune, die sprach: Ich bin das A und O, der Erste und der Letzte und was Du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien ...« Das Jesuslamm öffnet das Buch mit den sieben Siegeln, sieben Posaunen erschallen, sieben Schalen des Zorns ergießen sich über die Erde, Feuer, Blut und Hagel regnen herab, Inseln verschwinden im Meer, die Sonne wird schwarz, Flügelrosse toben heran, es ist die Stunde der Apokalypse und dann den Menschen die Verheißung: »Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein.« Welch großes Versprechen und seine Einlösung in naher Zukunft, denn in den Zeiten vor uns ist die irdische Geschichte kurz. Das Christentum gab der Menschheit keine lange Frist.
Die Welt ist lange an Patmos vorbeigegangen. Patmos genügte sein Name: Insel der Offenbarung. Was mehr, als ein heiliger Ort der Christenheit zu sein? Bis noch vor wenigen Jahrzehnten kamen nur selten Besucher, Touristen kaum, Kreuzfahrtschiffe in den Hafen von Skala nie. Die Fährverbindung von Piräus beschränkte sich auf die Sommermonate. Die mythische Ferne der Insel dauerte. Als 1965 der Pater Franz Weiss aus Deutschland anreiste, notierte er, die Insel sei dem »Blickfeld Europas« entrückt. »Kein Ort des Erdkreises wird so viel genannt und ist gleichzeitig so wenig bekannt und verhältnismäßig so schwer zu erreichen wie die Insel Patmos im Ägäischen Meer.« Im Sommer 1972 kreuzte ein prominenter Deutscher mit seiner Segeljacht vor der Insel. Auch er zeigte sich mit der Gegend unvertraut. »Patmos? Patmos, diesen Namen habe ich schon einmal gelesen«, soll Axel Springer gesagt und in die Bordbliothek gegriffen haben. Springer erhielt Unterrichtung und errichtete sich ein »Refugium« auf der Insel. Nach dem ersten Besuch ließ er sich in der Folgezeit meist mit dem Hubschrauber einfliegen.
Trotz des Prominenten ist aus Patmos kein Treffpunkt der Reichen und Schönen geworden. Mancher Ort profitiert davon, wer nicht kommt. In den Cafes am Hafen von Skala sitzen unter bunten Sonnenschirmen und herabgelassenen Markisen am Nachmittag die Touristen. Es ist die Zeit, wo die Ausflugschiffe von der nahen Insel Lipsi zurückkommen. Die großen Schiffe laufen ein und aus. Die kleinen liegen fest. In diesen Tagen bläst scharf der Wind. Draußen, wo die Welt ist, wo die Wellen der Ägäis sich jagen. Zu der einsamen Sandbucht von Psili Amos ist an diesem Tag kein Boot gegangen und es wird auch in den nächsten Tagen keines auslaufen. Psili Amos soll den schönsten Strand der Insel haben. Offen für eine schöne Brandung. Über das Festland so gut wie nicht zu erreichen. Ein Touristenziel. Unter den Arkaden des kleinen neoklassizistischen Verwaltungsbaus, den die Italiener am Hafen aus ihrer Besatzungszeit des Dodekanés hinterließen, residiert nach wie vor das alte eigensinnige Inselcafe. Aufrechte Holzstühle, schlichte Tische, zwei Männer spielen Tavla, die Steine schnellen hin und her, ein weißbärtiger Grieche lässt eine Perlenkette durch die Finger gleiten, zwei andere Männer trinken Tee, die schwarzgewandte Besitzerin des Cafes schaut, als bewache sie etwas. Wohl ein Stück Leben, das wir nicht kennen und vielleicht suchen. Was suchen wir, die wir hinzukommen? Das Licht der Ägäis? Hellenische Idealität? Gott? Die Versprechen der Reisekataloge? Die Offenbarung? Welche Sehnsüchte treiben uns? Hoffen wir, dass uns in der kurzen irregulären Ausnahmezeit auf einer griechischen Insel zu sein, offenbar wird, was wir suchen?
Zu Ostern erhöht sich die Einwohnerzahl von Patmos sprunghaft. Ostern auf Patmos ist ein Fest mit langer Tradition. Nur an wenigen Orten der Welt findet zu Ostern noch die szenische Darstellung des Abendmahls statt. Am Morgen des Gründonnerstags tritt die Prozession der Mönche aus dem Johanneskloster und schreitet durch Chora zur Platia Lotia vor dem Rathaus. Eine dichtgedrängte Menge erwartet sie, um Zeuge der Zeremonie der österlichen Fußwaschung zu werden. Der Abt vollzieht die Geste der Liebe und Demut an zwölf seiner Mönche, die zu dieser Stunde als die Jünger gelten wie er als Jesu. Die Geschichte von Tod und Auferstehung ist zum griechischen Osterfest überall auf Patmos zu treffen, in den Grablegungsprozessionen, im Anzünden der Kerzen am Karsamstag, im Ruf »Christos anesti«, Christus ist auferstanden, zur Mitternacht. Am Ostermontag kehrt Patmos auf die Erde zurück. Am Hafen von Skala erklingt Bouzouki-Musik.
Die Geschichte des »Festivals der geistlichen Musik« auf Patmos ist jung. Seit fünf Jahren trägt es im September zur Besucherzahl der Insel bei. Jeder ist eingeladen, der Eintritt ist unentgeltlich, jeder kann Haydn, Mozart, Chopin, Schubert, Bach, Michaelidis, Kalomiris, Maria Farantouri hören, die weltberühmte Theodorakis- Sängerin, von der Frankreichs Mitterrand gesagt hat »Maria ist für mich Griechenland«. Die Griechen in der Freilichtbühne neben der »Höhle der Offenbarung« empfangen sie leidenschaftlich. Jeden Abend zieht von Skala ein Strom von Menschen herauf. Wer sind wir? Udo Jürgens? Der Papst? Die Ausrichter einer Fußballweltmeisterschaft? Was ist das wirkliche Patmos?
Dass Johannes hier war und die Offenbarung empfangen haben soll, ist eine unsichere Geschichte. Die Zeugnisse sind steinern. Eine Felsgrotte mit einem dreifachen Riss in der Decke, aus der die Stimme schallte. Ein Steinblock als Pult der Niederschrift. Eine Mulde in der Wand, als Halt des Evangelisten beim Aufrichten nach dem Gebet. Aber da gibt es den Mann von der Küste Kleinasiens, Prochoros, der beansprucht, die Apokalypse nach dem Diktat des Johannes auf dem Steinpult aufgeschrieben zu haben. Kaiser Domitian soll die beiden im Jahr 96 in die römische Strafkolonie Patmos verbannt haben. Ist die »Offenbarung des Johannes« vielleicht die Offenbarung des Prochoros? In der Frühzeit des Christentums lief eine Vielzahl ähnlicher Schriften um. Benutzte Prochoros einen großen Namen, um sein Werk durchzusetzen? Auf jeden Fall hat er einen großen Text aufgeschrieben. Der Mönch Christodoulous, der 1088 auf die Insel kam, um ein Kloster zu errichten, hegte keinen Zweifel, dass Gott hier zu Johannes gesprochen hatte. Er nannte das neue Kloster »Johanneskloster«. Der Dichter Ludwig Harig hatte 1000 Jahre später auch keinen Zweifel, dass der Evangelist auf Patmos weilte. Nur dass der Dichter Ludwig Harig etwas andere Gründe dafür hatte als der Klostergründer Christodoulos.
Auf Patmos ist es schön. Johannes liebt den Ort,
das Wasser, das ihn wäscht, die Luft, die ihn erregt,
hat Himmel überm Kopf, der blau ist unentwegt,
und Boden unter Fuß. Ganz herrlich wohnt er dort.
Ein paar Jahrhunderte nach dem Christodoulos begegnen sich ein Abt des Johannesklosters und ein deutscher Dichter leibhaftig auf Patmos. Es ist der Juli 1944, der Deutsche heißt Erhart Kästner, er war einmal Privatsekretär Gerhart Hauptmanns, jetzt trägt er eine Uniform und hat den Auftrag, für den »Luftgau Südost / Athen« ein Buch über die griechischen Inseln zu schreiben. Die Ausführung des Auftrages bleibt ihm erspart. Der Mann in Lufwaffenuniform notiert unbefangen: »Ich war in Griechenland unterwegs, wie Deutsche von jeher waren: als Heimgekehrte. Wir sehen dieses Land mit Sehnsuchts- und mit Verklärungsblicken, mit Liebesblicken ...« Erhart Kästner war von Rhodos über Leros, Kalymnos, Kos nach Patmos gekommen und in einer »abliegenden« Bucht auf der Insel gelandet. Rhodos hatten die Explosionen britischer Luftangriffe erschüttert. Kos war im Oktober 1943 nach der Kapitulation Italiens in einem blutigen Landeunternehmen gegen britischen und italienischen Widerstand von der Wehrmacht genommen worden. Auf Kos waren nach der Eroberung 66 italienische Offiziere in Ausführung des »Führerbefehls«, Offiziere Widerstand leistender italienischer Verbände zu »liquidieren«, erschossen worden. Die deutsche Eroberung von Leros hatte der Abwurf von mehr als 1600 Tonnen Bomben begleitet. Die kleine italienische Garnison von Skala leistete vorsichtshalber keinen Widerstand, als am 20. November 1943 deutsche Minenräumboote in den Hafen einliefen. Der Abt des Johannesklosters sagt dem deutschen Besucher: »Was jener Johannes sah, reicht nicht an das, was jetzt geschieht in der Welt. Das aber sah er, dass das Schlimmste dem Menschen vom Bruder geschieht.« Der deutsche Besucher philosophiert mit dem Abt. »Glaubt ihr weniger Schuld zu haben, weil ihr nicht handelt?«
Im August ist Kästner wieder auf Rhodos. Im Juli hat die Deportation der griechisch-jüdischen Inselbevölkerung von Rhodos und Kos durch SS und Gestapo begonnen. Von den 2000 Verschleppten überleben nur wenige. Wo war Kästner als er auf Patmos war? »Auf dem Inselberg, den die Menschheit verehrt, ... wo die Offenbarung sich herbeiließ in goldenem Strahl, ... im Antlitz der Küste, wo die Philosophie dem Meer entstieg.«
Die Zeit auf der Insel endet. Hatte ich auch einen Traum dabei? Es fällt mir keiner ein. Nur dass ich in der Taverne in Grikos, wo die Stühle im Sand des Strandes stehen, lange am Mittag und in der Nacht auf Meer und Himmel geschaut habe und daran Genüge hatte.
Der Taxifahrer jagt unerschrocken durch die Kurven der Küstenstraße von Grikos nach Skala. Die Fähre nach Piräus wartet. »Number One«, sagt der Taxifahrer und lacht. Ich verstehe. Wir sind es der roten »1« auf dem Autodach schuldig. Noch nie habe ich von einem Taxiunfall auf der Insel gehört. Auf Patmos ist man dem Himmel ein Stück näher.
 Werner Liersch, geboren 1932, gelernter Werkzeugmacher und studierter Germanist, war Lektor, Redakteuer und lebt jetzt als freiberuflicher Autor in Berlin. Zu seinen Buchveröffentlichungen gehören: »Hans Fallada. Sein großes kleines Leben«, »Eine Tötung im Angesicht des Herrn Goethe. Ein deutscher Reiseroman«, »Goethes Doppelgänger. Die geheime Geschichte des Doktor Riemer«, »Das romantische Gebirge«, »Geschichten aus dem Antiquariat«, »Fallada. der Büchersammler. Der Literaturkritiker. Der Photographierte. Der Missbrauchte«.
Werner Liersch, geboren 1932, gelernter Werkzeugmacher und studierter Germanist, war Lektor, Redakteuer und lebt jetzt als freiberuflicher Autor in Berlin. Zu seinen Buchveröffentlichungen gehören: »Hans Fallada. Sein großes kleines Leben«, »Eine Tötung im Angesicht des Herrn Goethe. Ein deutscher Reiseroman«, »Goethes Doppelgänger. Die geheime Geschichte des Doktor Riemer«, »Das romantische Gebirge«, »Geschichten aus dem Antiquariat«, »Fallada. der Büchersammler. Der Literaturkritiker. Der Photographierte. Der Missbrauchte«.ND-Foto: Burkhard Lange
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.