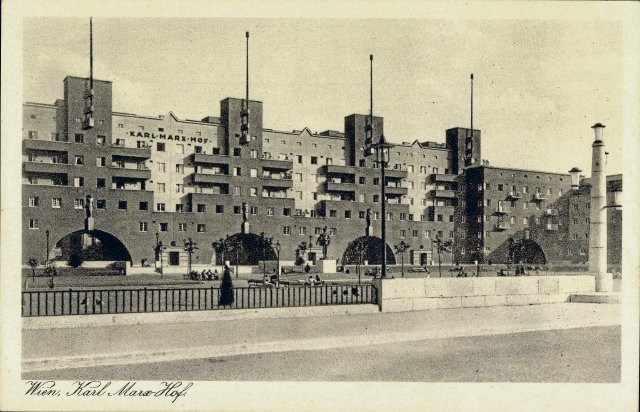Geschlossene Gesellschaft?
Jürgen Amendt über die soziale Zusammensetzung der Professorenschaft an deutschen Unis
Mit der Öffnung der Universitäten für nichtakademische Schichten Anfang der 1970er konnten auch in Westdeutschland mehr Arbeiterkinder studieren. Doch zu einer sozialen Egalisierung an den Hochschulen ist es damit längst nicht gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Vor allem in den höheren Etagen der Hochschulen bleiben die arrivierten Schichten unter sich. Die Mehrheit der Uni-Professoren entstamme auch heute noch der Ober- und der oberen Mittelschicht, so die Hans-Böckler-Stiftung. Während der Anteil von Studenten mit niedrigem sozialen Status ab 1963 von etwa zehn Prozent bis 1976 auf 18 Prozent kontinuierlich anstieg und sich auch in der Folgezeit erhöhte, stagnierte in den 1980er Jahren der Anteil dieser Herkunftsgruppe unter den Professoren bei 12 Prozent; in den 1990ern sank er gar auf rund 10 Prozent. Die höchste soziale Schicht stellte im Gegenzug vor 30 Jahren 30 und vor zehn Jahren gar 38 Prozent der habilitierten Hochschullehrer. Besonders groß ist die soziale Kluft unter den Juristen (80 Prozent Angehörige aus der Ober- und oberen Mittelschicht) und Medizinern (72 Prozent), wohingegen bei den Ingenieuren sowie Natur- und Geisteswissenschaftlern die soziale Kluft vergleichsweise gering ausgeprägt ist.
Ist die Alma mater also nach wie vor eine geschlossene Gesellschaft, in der sich das gehobene Bürgertum abschottet und seine Pfründe vor den nach sozialem Aufstieg drängenden aus den niederen Ständen mit aller Macht verteidigt? Die Antwort ist schwieriger, als man zunächst annehmen möchte. Sicherlich gehören Professoren zu den Berufsgruppen mit dem höchsten sozialen Ansehen und den besten Verdienstmöglichkeiten. Längst aber haben sich abseits des Universitätssektors Möglichkeiten des beruflichen und sozialen Aufstiegs aufgetan, die denen, die die Hochschule bietet, in nichts nachstehen. Möglicherweise verzichten viele Hochschulabsolventen niederer sozialer Herkunft ganz bewusst auf eine Hochschulkarriere.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.