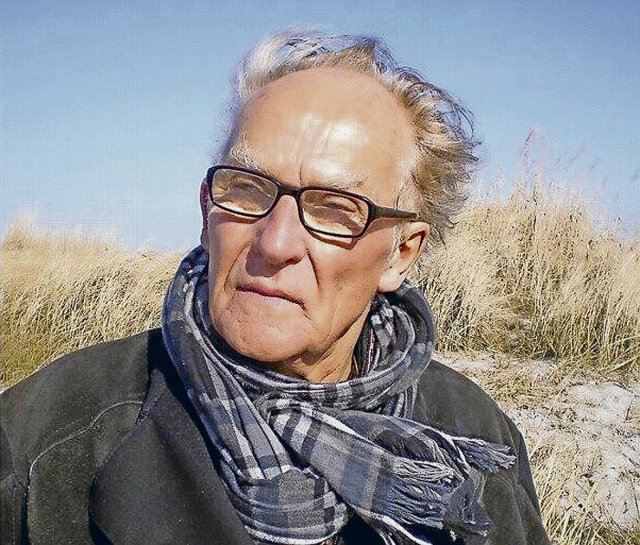Eroberung der Zwischenräume
Sprache ist das Mittel der Annäherung: Die »Chamisso-Autoren« erzeugen intelligente Sprachmixturen, die der gesellschaftlichen Entwicklung voraus sind
Europa streitet über seine Flüchtlinge, spricht von Überforderung oder gar Überfremdung. Die Rede von der Multikulti-Gesellschaft gilt manch einem gerade angesichts der aktuellen Konflikte um brennende Asylbewerberheime als naiv. Vielleicht, weil sie zumindest im politischen Umfeld einen phrasenhaften Charakter annimmt. Für die Literatur kann man das nicht sagen. Unter den sogenannten »Chamisso-Autoren« hat sich längst eine künstlerische Gruppe herauskristallisiert, deren literarisches Schaffen schon seit vielen Jahren deutlich weiter ist als all die so zähen wie populistisch geführten Debatten um Integrationswilligkeit oder Sozialschmarotzertum. Kategorien hat man zugunsten einer bunt-experimentellen Praxis aufgegeben.
Während die politische Elite über Sprachkompetenzen, Parallelgesellschaften und Klassifikationen der Flüchtlinge diskutiert, haben jene Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Migrationshintergrund, die auf Deutsch schreiben, Grenzen im Kopf hinter sich gelassen. Sie haben erkannt, dass kulturelles Zusammenleben vor allem sprachlicher Begegnungen bedarf. Und das heißt: Man redet nicht darüber, sondern man macht es einfach.
Als »Chamisso-Autoren« werden deutschsprachige Schriftstellerinnen und Schriftsteller bezeichnet, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die zuweilen wegen ihrer Betonung der Andersartigkeit kritisierte Bezeichnung »Chamisso-Literatur« geht zurück auf den Adelbert-von-Chamisso-Preis, der seit 1985 jährlich von der Robert Bosch Stiftung vergeben wird. »Ausgezeichnet«, heißt es in der 2012 neu formulierten Definition des Preises, »werden herausragende Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur von Autoren, die vor dem Hintergrund ihres eigenen Sprach- und Kulturwechsels Aspekte interkultureller Existenz sprachkünstlerisch gestalten.« Adelbert von Chamisso (1781-1838) war ein preußischer Dichter und Naturforscher französischer Herkunft. nd
Wider nationalstaatliche Schranken im Bewusstsein ergießt sich die Wortkunst zeitgenössischer Autoren in einem Strudel der Kulturen. Für Ilma Rakusa etwa stellt Berlin sinnbildlich ein gedeihendes Biotop aus Kreativität und multiethnischer Koexistenz dar. »Ich lese die Stadt wie ein Palimpsest, mit all ihren Leer- und Bruchstellen.« Die Tagebuchskizzen der ursprünglich aus der Slowakei stammenden Flaneuse, erschienen unter dem Titel »Aufgerissene Blicke. Berlin-Journal« (2013), reichen von den Niederungen des Straßenlebens, Spaziergängen über den türkischen Markt bis zu gemeinsamen Essen mit Schriftstellerkollegen. Die Stadt scheint ständig in der Schwebe zu sein.
Was sie beobachtet, formiert sie in Sprache: Das »Dünen-Berlin, prekär und ständig im Werden«, offenbart sich als ein Kraftfeld, das sie unentwegt zum Schreiben inspiriert. Es gibt an keiner Stelle nur das Bild der Metropole, vielmehr entpuppt es sich stets als wunderliches Terrain, das durch die Poetisierung in den Rang eines wahren Kunstwerkes gelangt. Die Multikulti-Mixtur geht dabei in einer facettenreichen Fabulierkunst auf. Zwischen deutschen Ausdrücken findet sich en passant allerhand englisches und anderssprachiges Material. Ein deutsches Berlin gibt es nicht, nur einen mondänen transistorischen Ort. Es gibt keinen Stillstand, sondern nur den Fluss der Menschen und all ihrer unterschiedlichen Wortströme, die einen globalen Sound erzeugen. Feridun Zaimoglus berühmt-berüchtigte Sammlung fiktiver Interviews »Kanak Sprak« (1995) hingegen bildete mit provokativem Gestus noch eine ganz eigene Alternativsprache heraus, die der bundesdeutschen, uniformen Mehrheitsrhetorik entgegenstehen soll.
Inzwischen scheint aus dem Gegen- oder Nebeneinander ein Ineinander geworden zu sein. Untrennbar, verschmolzen - das ist die Signatur hybrider Schreibweise. Während Rakusa diese im Laufe ihrer Karriere selbstbewusst zu verfeinern wusste und nunmehr formvollendet und praktisch anwendet, bietet Dorothee Elmigers zweiter Roman »Schlafgänger« (2014) eher einen philosophischen Blick auf die kulturelle Entgrenzung. Das schweizerische Talent entführt uns in schimmernde Zwischenreiche aus Halluzination, Erinnerung und Phantasmagorie. Der Leser lauscht einem Gespräch unter Lebenskünstlern, wirren Köpfen und Hobbydenkern, das ihm einen rätselhaften Erzählkosmos eröffnet. Statt auf eine lineare Handlung setzt die Elmiger auf skurrile Miniaturgeschichten. Man spricht über ferne Orte, das Übersetzen und stets von Grenzziehungen und -übertretungen. Übrig bleiben mehr Fragen als Antworten - ein Labyrinth aus tausend Möglichkeiten, wo jede Suche nach dem richtigen Weg scheitern muss. Im Gegenteil: Verlaufen ist erwünscht. Indem jede Figur für sich ihre eigenen Reiseerfahrungen schildert, überwinden sie gemeinsam imaginative wie auch politische Koordinaten.
In Zeiten, in denen das europäische Projekt nicht zuletzt durch nationalstaatliche Alleingänge und Pegida-Märsche mehr denn je zur Disposition steht, liest sich Elmigers Text wie eine polyphone Anleitung zur gegenseitigen Anerkennung der Unterschiedlichkeit. Um Migration neu zu begreifen, driftet sie weder in weichgespülte Schicksalsgeschichten noch in ein Schubladen-Denken zwischen dem Eigenen und Fremden ab. Ferner wählt sie den Weg des permanenten intellektuellen Ideenaustausches, der den Leser an Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« erinnert. Dadurch gelingt es der 1985 im Kanton Zürich geborenen Schriftstellerin, die brisante Gemengelage zu problematisieren und politische Möglichkeitsräume anzudeuten, ohne aber banalen Lösungen aufzusitzen. Der Europäer und Kosmopolit entsteht im Kopf und in uneingeschränkter Kommunikation.
Sinnbildlich ist daher auch immer wieder die Rede von erfundenen Städten in Übergangsbezirken wie beispielsweise Texarkana (eine Kontamination aus Texas und Arkansas) oder Mexicali, »deren Name Mexico und California verbindet«. Wo einst staatliche Territorien die Karten teilten, gilt es, die kontinentale gedankliche Tektonik mit Liebe zum Konjunktiv, ja, zum Bloch’schen Potenzialitätsdenken neu zu verfugen. Selbstbewusst zeigt dieses Buch: Ein gewachsenes Europa braucht passionierte Erzähler, Übersetzer und allen voran eine vielschichtige Literatur.
Mit dem spanischstämmigen, 1961 in Hausach geborenen Lyriker José F. A. Oliver hat der Schwarzwald einen solch europäischen Seiltänzer in seiner Mitte, der mit großem künstlerischen Engagement die deutsche Sprache mit fremdartigen Klängen bereichert. Im Titel seines wohl bekanntesten Werkes »Mein andalusisches Schwarzwalddorf« (2007) wird man des programmatischen Spagats zwischen der Herkunftsregion seiner Eltern und seinem ganz persönlichen Fleckchen Heimat gewahr. Statt aber beide Sphären bloß einander gegenüberzustellen, weitet er die deutsche Sprache konsequent aus. Er dehnt sie förmlich, wodurch etwa in seinem Buch »nachtrandspuren« (2002) ganz neue Begriffskompositionen »zwiestadtzeit« oder »sprachschrittpuls« entstehen. Zerlegt er unser Sprechen in kleinste Silbenatome, lässt er dadurch alle trennenden Kategorien hinter sich. Diese anschließend frisch zu verknüpfen, ist der Kern einer Poetik, die kulturunabhängig Neues zu kreieren sucht.
Die deutsch-japanische Autorin Yoko Tawada nutzt dafür eine pointierte Metapher: In ihren drei Hamburger Poetikvorlesungen aus dem Jahr 2011 führt sie das Wasser als das Wesenskonzentrat ihres Schreibens, als Inbegriff eines fließenden Zwischenraums an, wo sich Kulturen ineinanderfügen und gleichsam Irritationsmomente erfahrbar werden. Ihr Gedicht »Die zweite Person Ich« aus dem Band »Abenteuer der deutschen Grammatik« hebt mit einfachen Worten auf die unterschiedliche Pronominalverwendung im Deutschen und Japanischen ab, das in dieser Hinsicht weitaus komplexer ist: »Als ich dich noch siezte,/ sagte ich ich und meinte damit/ mich./ Seit gestern duze ich dich,/ weiß aber noch nicht,/ wie ich mich umbenennen soll.«
Obschon hierin die Kollision zweier Denkräume veranschaulicht wird, haftet der deutschen Sprache nichts Gewaltsames an. Im Gegenteil: Der Text wertet sie geradezu auf. Er demonstriert ihren Ausdrucksreichtum, insofern sie dazu imstande ist, das ihr Fremde in Worte zu fassen und zu diskutieren. Ein derartiges Deutsch erinnert einerseits an einen Schwamm, der aufsaugt und sprachliche Osmosen ermöglicht. Andererseits wollen die Verse verstören, indem sie Sollbruchstellen aufzeigen. Um Sensibilität für das Andere zu entwickeln, erfordert es zuerst eine Schärfung des Bewusstseins für den Unterschied. Hybride setzen - dies hat Tawada genauestens erkannt - zunächst Grenzen voraus, bevor diese übertreten werden können.
Entgegen einer gesellschaftlichen Realität, die teils wieder Kräfte der Ausgrenzung und Abschottung mobilisiert, widersetzen sich die Chamisso-Nachfolger einfachen Landeszuschreibungen. Sie wollen nicht mehr jener Türke oder jene Slowenin mit »guten Deutschkenntnissen« sein, nicht mehr Geschichte und Klischees wie einen Ballast mit sich herumschleppen und in die Sonderecke für sogenannte Migrantenautoren geschoben werden. Ferner dokumentieren ihre Werken Alternativen und geben dem Uneindeutigen gegenüber der Fixierung den Vorrang. Wie so oft ist Literatur damit erfreulicherweise weiter, als es die soziale Evolution der Gesellschaft vermuten lässt.
Zitierte Literatur
Feridun Zaimoglu: Kanak Sprak. 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft. Rotbuch, 144 S., 12 €.
Dorothee Elmiger: Schlafgänger. DuMont. 160 S., 18 €.
Ilma Rakusa: Aufgerissene Blicke. Berlin-Journal. Droschl Wien, 116 S., 16 €.
Yoko Tawada: Abenteuer der deutschen Grammatik. Konkursbuchverlag, 62 S., 10 €.
José F. A. Oliver: nachtrandspuren. Gedichte. Suhrkamp, 115 S., 9 €.
José F. A. Oliver: Mein andalusisches Schwarzwalddorf. Essays. Suhrkamp, 136 S., 8,50 €.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.