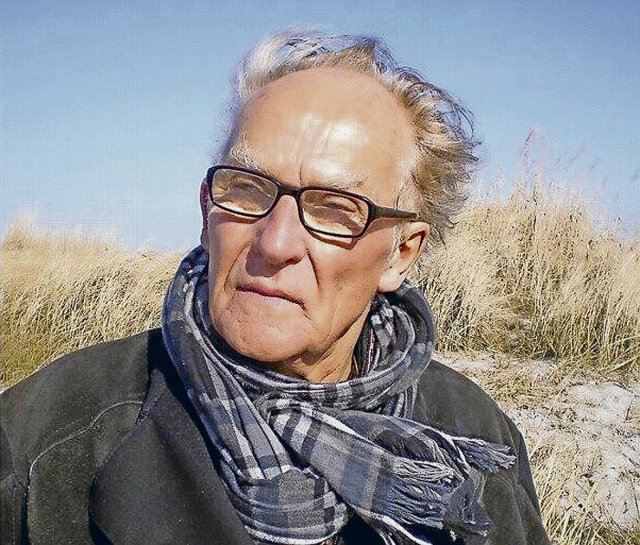- Kultur
- Georg Büchners »Woyzeck«
Die Maschine und das Menschlein
Georg Büchners »Woyzeck« am Schauspiel Frankfurt am Main und am Theater Basel
Wir wollen gut sein. Wir wollen fühlen, dass wir erbarmensfähig sind. Wir lösen eine Theaterkarte - für »Woyzeck«. Das ist die große Mitleid-Tankstelle. Büchner für jeden, der ein Herz hat. Und Wut. Georg Büchner hat geschrieben, geschrien: »Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt.« Da weiß man wieder, warum Heiner Müller den Woyzeck eine »Wunde« nannte. Die wühlt auch in unseren gegenwärtigen Umständen, die wir mehrheitlich als erträglich bezeichnen. Büchner rüttelt an der Realität - aber auch an Selbsttäuschungen. Denn er war nicht nur Revolutionär, sondern ebenso überzeugt vom bleibenden Leere-Horror der Welt. Das eine nicht ohne das andere. Dieser Widerspruch: noch so eine Wunde, die tiefste vielleicht. Unheilbar wohl.
Woyzeck - von der Frau betrogen, vom Arzt kaputt getestet, vom Hauptmann drangsaliert. Er wird zum Mörder am Liebsten, das er besitzt. Die Lust am Massaker grüßt aus dem Gestern - ins Heute. Wer weiß genau, was morgen in ihm geschehen könnte? In ihm - und mit ihm. In jenem undurchdringlicher werdenden Netz der Gesellschaften. Wo zappeln muss, wer nachweisen will, dass er - lebt. Wo aber Unterdrückung herrscht, wächst nicht zwangsläufig ein Freiheitswille, der sich aufständisch entlädt.
Einer der großen europäischen Schauspieler, Ekkehard Schall, spielte vor über vierzig Jahren den Woyzeck am Berliner Ensemble, er schrieb damals: »Woyzeck ist für mich ein fortwährend Gejagter. Er hätte dringend einer Form von Solidarität bedurft. Er vereinsamt, weil er sich mit niemandem verständigen kann. An technischen Gegebenheiten scheiterte, was ich zum Kern meines Spiels machen wollte: Ich wollte mich auf einer rotierenden Scheibe bewegen, und zwar ohne jedes Innehalten, die gesamte Aufführung hindurch - unablässig dieses Kreisen, das nicht zur Ruhe kommt.«
Büchners Stück wurde jetzt am Schauspiel Frankfurt am Main inszeniert, von Roger Vontobel (Bühne: Claudia Rohner), und am Theater Basel, Regie und Bühne: Ulrich Rasche. Frappierend: Beide Aufführungen sind Verkörperungen genau dessen, was Schall sich vorstellte. Die Welt als Drehscheibe. Als seien alle Glücksräder geschrumpft zum Rad, auf das der Mensch geflochten ist. In Frankfurt dreht sich die Bühne aufreizend langsam, atemlose Stille, in die das Knarren der Unterbühnen-Apparatur seltsame Höhlensignale sendet. Jana Schulz als Woyzeck steht in der Mitte, auf einem Inselchen aus Weidenrindenfetzen, sie schnitzt Stecken für den Hauptmann, um sie herum die Welt wie eine Wasser- oder Frostfläche. Mit jedem Schritt droht dieser Woyzeck einzubrechen ins Erdinnere.
Bewegt sich hier alles mit der gnadenlosen Langsamkeit eines Mahlwerkes, das seine malmende Kraft nicht durch Schnelligkeit bekräftigen muss, so steht Woyzeck in Basel auf einer weit schneller rotierenden Scheibe. Das kreisrunde Metall ruht auf einem ebenfalls sich drehenden Eisenmonstrum - ein prüfendes, peinigendes Rodeo für Fuß- und Kniegelenke. Geschäftsbetrieb einer enormen Militanz. Volle Kraft voraus auf immer gleicher Stelle. Für die Darsteller ein Körperkonzentrationsmarathon. Eine Pausenverweigerungsfolter. Die Scheibe kann kippen, nur Seile verhindern den Absturz. Am Ende hängen Woyzeck und Marie herab. Leben hängt in den Seilen. Wie tot am Strick.
Es gehört zur großen Qualität Rasches, dass sein Theater der tonnenschwer effektvollen Gerätschaft doch unbedingt ein Theater der Schauspieler bleibt. Die in Büchners Stück als ziemlich Festgelegte agieren müssen - Michael Wächter aber, Florian von Manteuffel, Thiemo Strutzenberger geben der Seelenlosigkeit, der sinnlichen Niedertracht, dem Faschismus von Tambourmajor, Doktor und Hauptmann eine überzeugende Leiblichkeit. Franziska Hackl als Marie wirft ihr Gemütspendel aus, von sinnbestimmter Gefasstheit zu sinnengetriebener Lust. Nicola Mastroberardino ist Woyzeck, schwarz gekleidet wie alle. Gibt groß den Grimm vor, der auf ihn zurückschlägt. Ein Käfigmensch auf der freien Wildbahn des Hasses, der Demütigung.
Licht wie aus einer Polarnacht. Eine Band spielt, als übersetze sie jedes Wort in Musik. Ein Trommeln auch, das sich gleichsam allen Hinrichtungen der Welt als spannungstreibende Begleitung anbietet. Büchners schmales, fragmentarisches Manuskript aufs Zerrfeld dreier Stunden gefesselt - das fesselt. Sätze gedehnt, Silben geschleppt - das Sprechen, im Chor, zu zweien, allein: eine Schmerzgeburt. Zwischen Starre und Hysterie. Immer frontal ins Publikum, während die Stiefel-Füße gegen die Laufrichtung tasten, Halt suchen müssen. Das verdreht die Körper. Das tut beim Zusehen weh.
Sozialer Realismus findet bei Rasche nicht statt. Nicht die handelsübliche Anklage der Verhältnisse. »Das läuft doch nur auf die Ewigkeit hinaus«, sagt der Hauptmann, und da arbeitet sie, die Ewigkeit: eine Maschinerie. Die Inszenierung schiebt uns am Ende dieses Metall-Monster nah vor die Augen. Wir sehen den Unterbau, das Gestänge, die Hydraulik, wahrlich: die eisernen Seilschaften. Das ist Schlundromantik. Offenlegung des kalten Herzens, das uns treibt. Die Kommandozentrale der Fremdsteuerung.
Sie wirkt wie eine spezielle Kontinuität: diese Feier der Form durch Formation. Die bindet und ballt. Rasche oder die Bühnen-Chöre von Bernd Freytag und Marcus Crome, die Kollektivwucht in Arbeiten von Volker Lösch, der Rhythmus-Rumor und die Takt-Texturen des Regisseurs Peter Atanassow im Berliner Gefängnistheater »aufBruch«: alle inspiriert von Einar Schleefs chorischen Überfällen. Just das Exerzitium gibt dem Theater eine besondere Freiheit: Fühlung aufzunehmen zum Archaischen. Das in Befragungen deutschen Erbes den aufreizenden Verweis auf einen totalitären Anhauch nicht verleugnet.
In Frankfurt trennt ein gleißend glitzernder Vorhang aus Elektroleuchten Woyzeck von der Hinterbühne, wo alle Spieler auf ihren Auftritt warten. Wo rote, bläuliche Himmelsstreifen zucken wie das Wetterleuchten verlöschender EKG-Ströme. Und von wo Rufe hereindringen, Gelächter. Und per Video auf den Vorhang geworfen, diskowild und partygeil - Welt stattfindet. Der Tambourmajor von André Meyer, im fellbesetzten Mantel überm Unterhemden-Wanst: ein dumpf-lauter Animateur der Enthemmung, der mit dem zynisch-mokanten Doktor des Matthias Redlhammer und dem giftig sich spreizenden Hauptmann des Wolfgang Pregler ein Trio infernale bildet. Dem Marie auf eine Weise verfällt, die auch nur ihren Haftaufenthalt im RTL-Gemüt aufzeigt. Ein Kind singt berührend Schumann: »Mondnacht«, kriecht verloren unters mitspielende Klavier.
Das Erlebnis in Frankfurt ist, erwartungsgemäß: Jana Schulz. Diese Große deutschen Schauspiels. Zerbrechlich, aber in ständiger Gegenwehr gegen diesen Eindruck: also robust, mit Lust eckig, roh. Doch die Stimme so zart. Eine Amazone, als tanze sie auf Scherbenkanten. Schulz entwickelt eine Laufbewegung, die immer auch ein Stocken, ein ungelenkes Stillstehen bleibt. Der Laufschritt im Delirium. Eine kleine Seele im großen Rotz der Welt. Der Mensch? »Staub, Sand, Dreck?« Große Lettern auf dem Vorhang.
Fast staunend beobachtet dieser Woyzeck, wie sich ungeheure Dinge in ihm vorbereiten. Dieses Menschlein im Soldatenrock überkommt mehr und mehr jene Idiotie des Kreatürlichen, die fleht, kein Geist möge es mehr aufstören. Das ist jene Form der Weisheit, die wir dann, wenn das Bewusstsein uns foltert, so sehr an den Tieren beneiden. Wenn der Geschundene die Marie tötet, steht sie neben ihm, Woyzeck aber wird das Messer - während sie fällt - mehrfach nach vorn ins Publikum rammen. Begleitet von einem Geräusch, als fauchten Tarantinos Säbel aus »Kill Bill« (Perkussion: Yuka Ohta).
Frankfurt zeigt das erschöpfte Wesen Mensch im Räderwerk, Basel das Räderwerk als Wesen der Schöpfung. Der Woyzeck in Frankfurt hat gemordet, betritt jetzt die Zone hinterm Lichtvorhang, der blendet auf wie nie. Der Woyzeck in Basel gesteht seinen Mord - und ist ebenfalls umstrahlt vom Lichtkranz. Was höllenfeuerweiß aufflammt - es ist an beiden Orten ein Glühen auch der Erlösung. Büchner wie Goethe, Woyzeck wie Gretchen: »Gerichtet? Gerettet.«
Vontobel setzt einmal mehr auf die Irritation »seiner« starken Schauspielerin Jana Schulz, Rasche erneut auf sein Maschinen-Mensch-Theater, das so eindringlich, so gemütsfräsend zu Werke geht. Und das dich mitreißt, dich runterreißt - wie es sich gehört für uns alle, die wir Mitredner sind und doch keine Leere füllen. Im Elend, dem nicht beizukommen ist. Beide Regisseure schreiben daher ihr Theater mit dem Hartstift des Trostlosen. Zweimal Theater, das dich vom Sockel der festen Einbildung stößt, alles in der Welt müsse gut ausgehen. Wo ist das verbindlich ausgemacht, von wem, mit wem?
Nächste Vorstellungen: 19., 20. Oktober (Frankfurt); 12., 13. Oktober (Basel)
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.