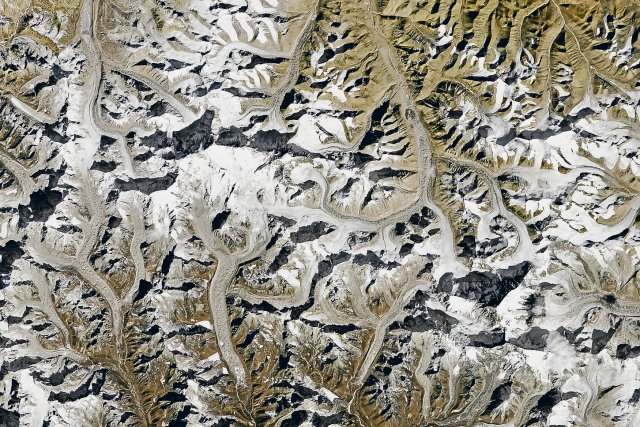- Wissen
- Schlafen
Hinlegen und Sterben
Wache halten oder Durchschlafen? Die Nachtruhe hat eine bewegte Geschichte.
Wer nachts aufwacht, kurz auf die Uhr schaut, um gleich wieder zurück in Morpheus Arme zu sinken, kann sich zu den glücklichen Schläfern zählen. Manchmal legt das Hirn aber den Schalter um und der Kopf spult mitten in der Nacht alles ab, was auf der Seele lastet. Dabei mahnen die oszillierenden Uhrzeiger zum Weiterschlafen. Der Wettlauf mit der Zeit beginnt und mit ihm kommt die Angst, sich übermüdet durch den immer näher rückenden Tag zu quälen.
Das ist ein Alltagsszenario, das kommt und geht. Nur wenn es bleibt, wenn der Schlaf jede Nacht durch zermürbend lange Wachphasen unterbrochen wird und bleierne Müdigkeit und Unlust am Tag jede Tätigkeit erschwert, ist ärztlicher Rat gefragt. «Gut schlafen ist für unser körperliches und psychisches Wohlbefinden sehr wichtig», betont nicht nur die Privatdozentin Ilonka Eisensehr, die an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) zum Thema Schlafstörungen geforscht hat. Ihren Erkenntnissen zufolge leidet in Deutschland etwa jeder Zehnte an chronischen Schlafstörungen. Die Ursachen dafür sind so vielfältig wie die Symptome. Da gibt es das Restless-Legs-Syndrom - also unwillkürlich zappelnde Beine -, da gibt es sogenannte Parasomnien wie das Schlafwandeln oder Zähneknirschen, es gibt Atemstörungen (Schlafapnoe) mit teilweise kurzen Aussetzern und es gibt undefinierbare Störungen der REM-Schlafphasen («rapid-eye-movement»), bei denen Trauminhalte mitunter in die Tat umgesetzt werden - was für Betroffene gar nicht traumhaft ist. Letzteres ist eher selten. Doch von der verbreitetsten Störung - Ein- oder Durchschlafproblemen - ist hierzulande jede Person betroffen, so die Münchner Fachärztin.
Nach aktuellen Schlafstudien der Krankenkasse DAK leiden 80 Prozent der arbeitenden Bevölkerung häufig und zehn Prozent sogar chronisch unter Schlafstörungen. Einen etwas anderen Maßstab legt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zugrunde: Danach gehen Erwachsene in der Regel um 23 Uhr ins Bett, fallen nach durchschnittlich 15 Minuten in den Tiefschlaf und stehen erst nach einem Schlafblock von sieben Stunden wieder auf. Dieses Idealschlafmuster erreicht laut DIW allerdings von sieben im Berufsleben stehenden Personen nur eine. Noch trüber klingt die Schlafbilanz nach Untersuchungen der Techniker Krankenkasse (TK). Danach erreichen nicht einmal 25 Prozent die ärztlich empfohlene Mindestschlafdauer von sechs Stunden pro Nacht. Die wirtschaftlichen Verluste durch daraus resultierende Krankheiten schätzt die US-Agentur Rand Corporation auf 411 Milliarden Dollar pro Jahr in den USA und 55 Milliarden Euro in Deutschland.
Verweisen diese unterschiedlichen Erhebungen und Daten auf eine neue Epidemie der Schlaflosigkeit? «Natürlich nicht», sagt der Wissenschaftshistoriker Philip Osten von der Universität Heidelberg, der unter anderem zur Geschichte des Schlafes forscht. «Schlaf ist nicht nur Endokrinologie, sondern immer auch ein kulturelles Produkt. Mit anderen Worten: Jede Zeit und Gesellschaft hat ihre Schlafgewohnheiten.»
Die in Deutschland weit verbreiteten Vorstellungen von einem Idealschlaf, der vor Mitternacht beginnt, sind laut Osten ein Produkt der Industriekultur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Auf diese hingewirkt habe wohl auch der königlich-preußische Leibarzt Christoph Wilhelm Hufeland: Alle Arbeitskräfte sollten ausgeruht dem Rhythmus der Fabriken folgen können, ohne zwischendurch ein Nickerchen zu benötigen, forderte der Gesundheitsapostel. Die häuslichen Situationen boten damals indessen kaum die Möglichkeit für einen erquicklichen Schlaf. Osten erinnert daran, dass noch vor 100 Jahren in Berlin mehr als eine Million Menschen mindestens zu viert in einem Zimmer schliefen.
Für Forschungen, die sich zeitlich und räumlich vom westlichen Jetzt noch weiter wegbewegen, erscheinen diese «monophasischen» Standardmodelle fast selbst schon exotisch. Der Historiker Roger Ekirch von der Virginia Tech University vermutet, dass die prähistorischen Menschen erst nach und nach gelernt haben, die «gefahrvolle Dunkelheit» zu verschlafen. Gesichert aber sei, dass in Westeuropa die überwiegende Mehrheit bis zum Ende der frühen Neuzeit in den meisten Nächten in zwei längeren Zeitabschnitten geschlafen habe, die von einer mindestens einstündigen Wachphase meist nach Mitternacht unterbrochen war. In dieser nächtlichen Stunde legten sie nämlich Holz nach oder setzten sich ans Feuer. Was heute als Durchschlafstörung diagnostiziert wird, wäre demnach oft nur eine Wiederkehr dieses alten Musters. «Der nahtlose Schlaf, den wir heute anstreben, ist eigentlich etwas Unnatürliches, eine Erfindung der modernen Welt», so Ekirch.
Carol Worthman von der Emory University in Atlanta kann diesem «Hinlegen-und- Sterben-Modell», wie sie es nennt, erst recht nichts Normales abgewinnen. Als eine der ersten Vertreterinnen ihrer Zunft hat die Ethnologin systematisch die Schlafkulturen indigener Völker wie den Kung in Botsuana oder den Efe in Kongo untersucht und kam zu ähnlichen Ergebnissen. In afrikanischen Gesellschaften sei der Schlaf im sozialen Leben auch tagsüber viel fester verankert: Das Durchschlafen war hier sehr lange schon aus Sicherheitsgründen problematisch, etwa um Herden zu bewachen. Auch gebe es tief verwurzelte ethisch-religiöse Haltungen, etwa den Glauben, in langen Schlafphasen könne die Seele verloren gehen. So schliefen Männer, Frauen, Kinder und auch Haustiere in Gruppen zusammen, wobei die Erwachsenen abwechselnd aufstanden, um Wache zu halten, während die Hühner gackerten und das Feuer knisterte.
Diese «polyphysischen» Schlafgewohnheiten anderer Völker und Kulturen lassen sich allerdings nicht einfach auf moderne Industriekulturen übertragen. Jedes Kind wird in den ersten Wochen zum «biphasischen» Mittags- und Nachtschlaf und ab dem Schulalter auf den durchgehenden Schlaf während der Nacht erzogen. Das ist so weit verinnerlicht, dass sich das Muster nicht einfach ablegen lässt. Die ethnologischen Studien weisen aber darauf hin, dass sich die Menschen in den industrialisierten Ländern nicht bei jedem nächtlichen Aufwachen als Schlafversager sehen müssen. Das ist insofern tröstlich bis sogar heilsam, als auch die schulmedizinische Insomnieforschung, die sich mit der ganzen Bandbreite an Schlafstörungen befasst, immer wieder betont: Gerade die Angst vor Schlaflosigkeit führt sehr oft zu eben dieser.
Die Botschaft lautet also nicht: zurück in die Steinzeit - sondern man rät zu mehr Gelassenheit und Flexibilität. Viele Arrangements für den nächtlichen Schlaf oder das Nickerchen tagsüber sind vorstellbar. Manche Unternehmen sind bereits so flexibel, ein Zeitfenster für den erfrischenden Kurzschlaf - den «Power Nap» - bereitzuhalten, wenn die Leistungsfähigkeit in den Mittagsstunden ihren Tiefpunkt erreicht.
Und auch in den Schlafzimmern ist Bewegung eingekehrt. Nach Studien der österreichischen Schlaf- und Verhaltensforscher Gerhard Klösch und John Dittami bevorzugen heute viele Paare entgegen den Standardmodellen getrennte Betten. Nach Erkenntnissen der beiden Verhaltensforscher schlafen Frauen schlechter, wenn ein Mann neben ihnen liegt. Die Evolutionspsychologie liefert die Erklärung dafür: «Schlafen beim Partner bedeutet für Frauen häufig, an der Arbeitsstelle Familie zu schlafen», meint Klösch. Männer hingegen fühlten sich vom neben ihnen schlafenden Körper an die «Urrotte» erinnert und dächten: «Schön, da ist jemand, der auf mich aufpasst.»
Auch wenn die Urrotte Geschichte ist: Ganz allein wollen die wenigsten schlafen. «Etwa die Hälfte der Hunde und fast jede Katze darf sich das Bett mit Herrchen oder Frauchen teilen, schätzen Klösch und Dittami. Das bringt jedoch ein anderes Problem mit sich: Gut 20 Prozent der Hunde und zehn Prozent der Katzen schnarchen. Aber es ist eben auch schön, in Wachphasen das geliebte Tier neben sich zu wissen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.