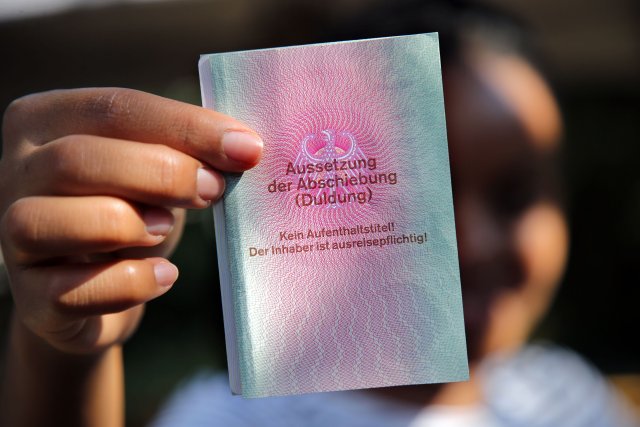- Politik
- Wohnungspolitik
Bremsen, deckeln, aber ohne Konsequenz
Die Wohnungspolitik der SPD ist keine Erfolgsgeschichte. Trotzdem werden in der Partei nur vereinzelt radikalere Maßnahmen gefordert
Die SPD hat in der Mieten- und Wohnungspolitik viel versprochen. Durch die von den Sozialdemokraten vorangetriebene »Mietpreisbremse« sollte Wohnen für die vielen Mieter hierzulande, die über keine hohen Einkommen verfügen, bezahlbar bleiben. Die neue Regelung wurde zum 1. Juni 2015 eingeführt. Sie sollte überzogene Mieterhöhungen nach einem Mieterwechsel verhindern. Doch besonders in beliebten Innenstadtbezirken stiegen die Mieten weiter. Dafür gab es einige Gründe. So hatte Linksfraktionsvize Caren Lay die vielen Ausnahmen kritisiert. Neubau, möblierte und modernisierte Wohnungen sind nämlich komplett ausgenommen. Zudem wurde die »Mietpreisbremse« nicht flächendeckend eingeführt.
In den vergangenen Jahren haben die Sozialdemokraten versprochen, die »Mietpreisbremse« zu verschärfen. Doch in der Koalition mit der Union, die sich oft auf die Seite der Vermieter schlägt, ist das nicht einfach. Hinzu kommt, dass die SPD davor zurückschreckt, radikale Forderungen zu stellen. Im Februar hatten sich zwar die Berliner Jusos dazu bekannt, mit dem Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« zu kooperieren. Aber in der Führungsriege ihrer Partei ist kaum jemand ein Freund von Enteignungen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatte den Weg zur Enteignung privater Wohnungsunternehmen zunächst nicht ausgeschlossen, später aber klargestellt: »Das ist nicht mein Weg und nicht meine Politik.« Die von der LINKEN und Politikern der Grünen unterstützte Initiative »Deutsche Wohnen enteignen« sehe er »sehr kritisch«, sagte der Sozialdemokrat.
Nicht einmal im linken Flügel der SPD dürfte es eine Mehrheit für Enteignungsforderungen in der Wohnungspolitik geben. Parteivize Ralf Stegner hatte etwa gesagt, dass dadurch keine einzige neue Wohnung entstehe und somit auch das Wohnungsproblem nicht gelöst werde.
Der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, hatte kürzlich in einem Gespräch mit der »Bild«-Zeitung ebenfalls Bedenken geäußert. Wenn überhaupt zulässig, würden durch Enteignungen massive Entschädigungsansprüche ausgelöst werden, so Miersch. »Notwendig ist aber, dass der Staat eine viel stärkere Rolle bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum einnimmt - sowohl durch das Bauen über öffentliche Wohnungsbauträger wie auch durch staatliche Intervention bei Spekulationen, zum Beispiel durch einen Mietendeckel«, sagte der SPD-Mann.
Damit haben sich führende Vertreter der SPD-Linken hinter Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles gestellt. Diese hatte zwar schon vor einiger Zeit erkannt, dass »Wohnen die neue soziale Frage ist«. Aber gegenüber der »Bild am Sonntag« hatte Nahles Mitte des Monats gesagt: »Ich verstehe die Wut auf Wohnungskonzerne, die jeden Cent aus den Mietern rauspressen wollen. Aber Enteignung dauert Jahre und schafft keine einzige Wohnung.« Befürworter von Enteignungen verweisen hingegen darauf, dass dieses Instrument im Grundgesetz verankert ist und somit wirtschaftliche Macht zugunsten von Mietern beschränkt werden kann.
Damit dürfte die Diskussion bei den Sozialdemokraten nicht abgeschlossen sein. Auf kommunaler Ebene gibt es SPD-Politiker, die in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt über Enteignungen zumindest nachdenken. Die SPD-Stadtverordnete Esther Gebhardt aus Frankfurt am Main hatte kürzlich erklärt, dass eine Enteignung kein Tabu sein dürfe, wenn man den »Mietenwahnsinn« stoppen wolle. Denn der freie Markt habe versagt. Dagegen sagte CDU-Fraktionschef Michael zu Löwenstein: Der verbürgte Schutz privaten Eigentums sei eine wesentliche Voraussetzung für mehr Investitionen in zusätzliche Wohnungen. Mit der CDU sei »Wohnen wie in der DDR« nicht zu machen. In Frankfurt regiert ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen.
Die Bundesregierung setzt auf andere Strategien. Sie hat eine »Wohnraumoffensive« angekündigt. 1,5 Millionen neue Wohnungen sollen bis 2021 entstehen. Verantwortlich hierfür ist der Innen- und Bauminister Horst Seehofer (CSU). »Eine Sonderabschreibung für Mietwohnungen in Höhe von 20 Prozent der Neubaukosten soll dabei helfen. Dafür schüttet die Große Koalition zwei Milliarden Euro an Steuersubventionen aus, ganz ohne soziale Bindung. Davon profitieren nicht in erster Linie Mieterinnen und Mieter, sondern Investoren«, hatte Caren Lay im vergangenen Jahr kritisiert.
Zwar hat sich die Koalition auch auf Änderungen bei der »Mietpreisbremse« geeinigt, aber wenn diese zur Anwendung kommt, sollen künftig Mieterhöhungen bis zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete möglich sein.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.