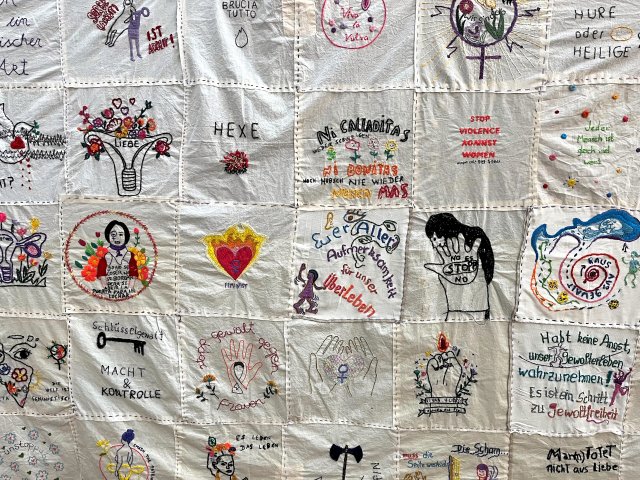- Berlin
- Landesamt für Einwanderung
Willkommensbehörde mit Abschiebelizenz
Eröffnung des neuen Landesamts für Einwanderung / Verbände kritisieren einseitige Fokussierung auf Fachkräfte
Der erste Eindruck ist der wichtigste - und er kann nicht rückgängig gemacht werden. Und da in der Hauptstadt Fachkräfte händeringend gesucht werden und die Ausländerbehörde für viele von ihnen der erste Kontakt mit deutschen Behörden ist, versucht Berlin es mit einem Imagewechsel: »Wir müssen einwanderungswilligen Menschen vermitteln, dass sie willkommen sind«, sagt Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch bei der Eröffnung des bundesweit ersten Landesamts für Einwanderung in Mitte. »Die Berliner Wirtschaft ist dringend auf die Einwanderung von Fachkräften angewiesen«, so Geisel weiter. Dafür brauche es eine bessere und schnellere Beratung und eine gelebte Willkommenskultur. »Da ist noch Luft nach oben.«
Für den Innensenator ist die Eröffnung des neuen Landesamtes, das die bisherige Ausländerbehörde ersetzt, ein »historischer Moment«. »Berlin ist schon immer eine Einwanderungsstadt gewesen. Einwanderer haben Berlin groß gemacht«, sagte der SPD-Politiker bei der feierlichen Zeremonie mit rund 160 Gästen. 180 Nationen lebten in Berlin, die mit ihren unterschiedlichen Kulturen die Stadt prägen würden. In Zeiten des Rechtsrucks sei die neue Behörde daher »ein wichtiges Symbol für Weltoffenheit und Toleranz«.
Engelhard Mazanke, seit 2011 Direktor der Ausländerbehörde und nun auch Leiter des neuen Landesamtes, betont, dass dieses mehr sei als nur ein Symbol. »Das ist nicht nur ein neues Türschild. Damit verbindet sich auch ein gewisser Anspruch«, sagte Mazanke am Mittwoch. So soll es im neu geschaffenen Landesamt eine zentrale Beschwerdestelle, eine Rechts- und Verfahrensberatung sowie einen Dolmetscherservice geben. Mit dem neuen Landesamt bereitet sich Berlin laut Geisel schon jetzt auf das neue bundesweite Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor, das ab dem 1. März in Kraft treten soll. Der Innensenator geht davon aus, dass dadurch jährlich 6000 Zuwanderer*innen nach Berlin kommen werden. Für die neuen Aufgaben bekommt das Landesamt rund 70 neue Stellen zusätzlich zu den bisherigen 470 Mitarbeiter*innen.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) lobte am Mittwoch die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung, weist allerdings auf nach wie vor fehlende personelle und räumliche Kapazitäten hin. »Im Doppelhaushalt sind die zusätzlich benötigten Stellen berücksichtigt. Jedem dürfte aber klar sein, dass wir die Stellen mit Menschen besetzen müssen und es noch mehr räumliche Kapazitäten geben muss, wenn wir die gewünschten Leistungen erbringen sollen«, sagte die GdP-Bezirksgruppenvorsitzende Manuela Kamprath.
Auch Safter Cinar vom Türkischen Bund Berlin-Brandenburg (TBB) ist skeptisch, ob 70 neue Stellen ausreichen werden, um den neuen Herausforderungen zu begegnen, die etwa durch den Brexit auf Berlin zukommen werden. Der TBB-Vorstand betont, dass die neue Behörde für alle Migrant*innen zuständig ist. »Die Mehrheit der Einwanderer sind keine Fachkräfte. Sie sollten genauso willkommen geheißen werden«, mahnt er.
Der Flüchtlingsrat Berlin glaubt nicht, dass sich durch die Namensänderung etwas ändert. »Wir fordern statt der symbolischen Umbenennung die inhaltliche und kulturelle Neuausrichtung der Behörde«, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Der neue Name täusche darüber hinweg, dass das Amt weiterhin auch für Abschiebungen zuständig ist. Pro Jahr seien das rund 1000 Menschen, dazu kämen weitere 1000, die Berlin »freiwillig« verlassen. Die Schaffung des neuen Landesamtes müsse zum Anlass genommen werden, in allen Bereichen eine humanitäre Umsetzung des Aufenthaltsrechts umzusetzen - »und zwar auch in den Abteilungen, die nicht mit der Fachkräftezuwanderung befasst sind«.
Auch Safter Cinar hofft, dass die neue Behörde mehr im Sinne der Betroffenen arbeitet. Der TBB hat dafür gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat und anderen Verbänden Vorschläge für eine humanitäre Umsetzung des Aufenthaltsrechts durch die Ausländerbehörde erarbeitet, von denen einige auch angenommen wurden. »Es gibt Ermessensspielräume, die wir zum Wohl der Stadt kreativ nutzen wollen«, betont auch Geisel und verweist auf die jüngste Lockerung der Arbeitsverbote für Geduldete.
Sollte das neue Landesamt dann doch einmal nicht im Sinne der Einwander*innen entscheiden, können sie sich an den TBB wenden, der dort einmal in der Woche Beratungen anbietet. »Dass eine Behörde es erlaubt, gegen sie Beratung zu machen, das ist einmalig«, freut sich Cinar.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.