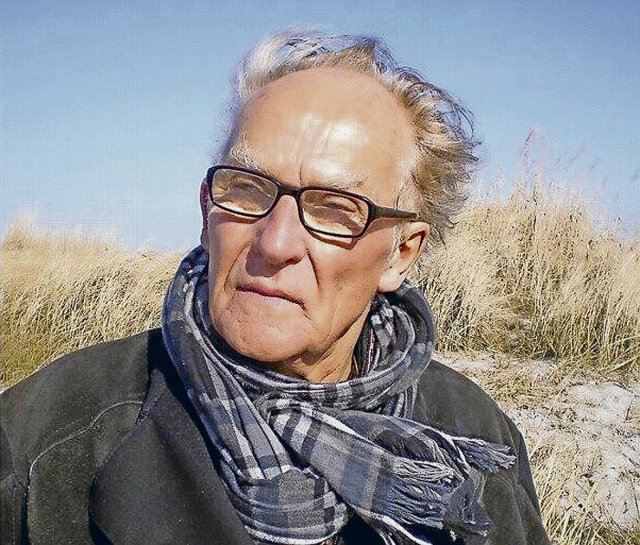- Kultur
- Musikfest Berlin
Weltbewegende Erschütterungsmusik
Georges Aperghis, Yú Gōng, Wozzeck und Alfred Schnittke: Ein Wochenende beim Musikfest Berlin
Aus einer kleinen Akkordeonfigur entsteht nach und nach ein wildes Brausen von Klavier, Bläsern, Streichern und den sechs Sängerinnen und Sängern. Ein Durcheinander von Assoziationen, Figuren, Einsprüchen, Jammertönen und Melodiefetzen: »Welchen Weg kommst du her?« Die Uraufführung der neuen Komposition »Der Lauf des Lebens« des griechisch-französischen Komponisten Georges Aperghis beim Musikfest Berlin gerät zu einer musikalischen Gratwanderung, zu einem Parforceritt durch Gefühle, Stimmungen und Akklamationen. Aperghis hat eine wilde, mitunter albtraumhaft wahnsinnige, düster schillernde Musik komponiert, in der Fragmente aus Goethes »Faust« Fingerzeige geben.
Da ist ein forderndes Kontrabaßsolo zu hören (es ist ungerecht, aus dem großartigen Ensemble des Klangforums Wien einzelne Musiker hervorzuheben, aber famos: Sophie Lücke). Aus den Trommeln: Maschinengewehr-Geknatter. Dann wieder polyphone Strukturen, die zwischen Streichern und Bläsern hin und her zirkulieren. Wie ein exaltierter, sizilianisch-New-Orleanesker Trauermarsch in ein Saxofonsolo mündet, und wie das schließlich, zusammen mit den beiden Klavieren, geradezu rauschhaft vor sich hinjazzt - eine tolle, auf faszinierende Art unvorhersehbare Musik ist hier zu hören.
»Aperghis hat die Freiheit erworben, wie ein Akrobat auf dem Seil zu tanzen und dabei den Sturz zu riskieren«, sagte der französische Philosoph und Psychoanalytiker Félix Guattari über den Komponisten. »Doch im Gegensatz zu einigen anderen weiß er, dass der Akrobat im Falle eines Sturzes nicht in die Leere fällt, sondern auf weitere Seile, mit deren Hilfe er umso besser wieder emporschnellen kann!« Man könnte auch sagen, Aperghis Musik gleicht einem Bau mit vielen Eingängen. Wenn man Guattaris zusammen mit Gilles Deleuze verfassten Kafka-Text zitieren möchte: »Das Prinzip der vielen Eingänge behindert ja nur das Eindringen (…) des Signifikanten; es verwirrt allenfalls jene, die ein Werk zu ›deuten‹ versuchen, das in Wahrheit nur experimentell erprobt sein will.« Es wird kaum möglich sein, dieses neue Werk von Aperghis zu deuten, und warum sollte man dies überhaupt versuchen? Den Zuhörer*innen bleibt vor allem, das Gehörte zu erproben und mit bunten Assoziationen zu verbinden.
Da ist eine verfremdete »Spiel mir das Lied vom Tod«-artige Melodie in Bratschen-Tonhöhe vom Kontrabaß zu vernehmen, die von den anderen Streichern nach und nach fugiert übernommen wird. Die Blechbläser tönen von apokalyptischen Reitern, sie scheinen alles einzureißen, denn »das ist die Welt: / Sie steigt und fällt / Und rollt beständig; / Sie klingt wie Glas: / Ist hohl inwendig«, wie es bei Goethe heißt. Doch kurz bevor die Welt aus Glas zersplittert, wispern und trällern die zwei Soprane und der Mezzosopran wild durcheinander. Es geht also weiter. Und von den Männerstimmen tönt, zurückgenommen und trocken, das Goethesche Hexeneinmaleins. Der Komponist läßt uns spüren: Es gibt Momente, da ist er verloren, und alles hört auf. Um mit neuer Energie neue Eingänge zu finden. »Ich kam daher auf glatten Wegen, / Und jetzt steht mir Geröll entgegen.« Verdammtes Geröll! Der Komponist wird fast zum wunderlichen Alten Yú Gōng aus der bekannten chinesischen Legende, er muss Auswege suchen aus dem Geröll, das die Lebenswege versperrt.
Georges Aperghis hat eine sinnliche, mitunter verzweifelte, dann wieder Hoffnung schenkende, weltbewegende Erschütterungsmusik geschrieben, deren furiose Uraufführung durch das Klangforum Wien und die Neuen Vocalsolisten Stuttgart unter der markanten Leitung von Emilio Pomàrico einen faszinierenden Höhepunkt des diesjährigen Musikfests darstellt. Das wird bleiben.
Warum allerdings ist diese Aufführung nur drei Tage digital auf der Webseite der Berliner Festspiele zu sehen und zu hören? Drei Tage! Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird der Mitschnitt also bereits wieder gelöscht sein, und es ist zu befürchten, daß der Komposition das gleiche Schicksal droht wie dem 2018 an gleicher Stelle uraufgeführten »Migrants«, das seither nicht mehr zu hören war: Es gibt keine Aufnahme, keinen Mitschnitt, nirgends ist diese Musik zu finden. Wir hören Gegenwartsmusik immer noch wie zu Beethovens Zeiten: Ein paar Glückliche erleben die Uraufführung und vielleicht noch ein, zwei weitere Konzerte, die anderen erfahren nur durch Texte und Besprechungen von diesen Werken; zu hören sind sie nicht, nirgends. Als ob die Erfindung von Tonträgern und Internet nicht existieren würde. So wird die Beschäftigung mit dieser Form von Gegenwartsmusik auf einen elitären bildungsbürgerlichen Kreis beschränkt.
Es fehlt auf allen Ebenen am unbedingten Willen zur Musikvermittlung. Die Konzerteinführungen, die gerade bei neuen Werken wertvolle Fingerzeige geben können, fallen Corona-bedingt aus. Warum allerdings auch die sonst beim Musikfest so hervorragenden Programmhefte dieses Jahr fehlen und bloße Besetzungszettel ausliegen (und die nicht einmal in ausreichender Auflage, beim Aperghis-Abend gehen etliche Besucher*innen leer aus), ist nicht zu verstehen. Das gilt auch für das erste Konzert des Klangforums Wien mit Werken von Rebecca Saunders. Ohne jegliche Erklärung und Einführung bleibt ein Werk wie »Flesh for solo accordion with recitation« unverständlich, zumal der Text, vermutlich absichtlich, nicht zu verstehen war. Der Akkordeonist erinnert so an eine dieser Gestalten, die einem mitunter in Berliner U-Bahnen begegnen, die wirres, unverständliches Zeug vor sich hin brabbeln, mitunter sehr laut, dann wieder in sich zusammensinkend; man will ihnen eigentlich lieber nicht begegnen und ist froh, wenn man ihnen aus dem Weg gehen kann. Avantgardistisches Kasperletheater. Das kann doch niemand wollen, dass die eingefleischten Avantgarde-Fans und die Funktionäre für zeitgenössische Musik, die in der Mehrzahl das karge Publikum dieses Konzerts in der Philharmonie bildeten, unter sich bleiben.
Großartig gelang die Uraufführung von Rebecca Saunders‘ »to an utterance - study« für Klavier durch Joonas Ahonen: Eine Art Etüde in ausufernden Glissandi, die in Clustern enden, häufig werden tiefe Töne aus diesen Akkorden lang angehalten, brutale Ausbrüche, Wellenbewegungen, virtuos und faszinierend interpretiert.
In Sachen Musikvermittlung macht dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) niemand etwas vor: Die Konzerteinführungen werden Corona-bedingt kurzerhand ins Netz verlegt, wo man vorab auch das ausführliche und wie immer mit hervorragenden und instruktiven Aufsätzen von Steffen Georgi prall gefüllte Programmheft abrufen kann, das zusätzlich kostenlos an allen Eingängen der Philharmonie ausliegt. So soll es sein, ein wertvoller Beitrag zur musischen Bildung! Zum Musikfest steuert das RSB unter Vladimir Jurowski ein Konzert mit Werken von Webern, Berg und Schnittke bei, also einen Abend mit »klaren kulturpolitischen und ästhetischen Aussagen«, wie Georgi zurecht bemerkt. Ein Highlight: Die »Drei Bruchstücke für Gesang und Orchester aus der Oper «Wozzeck» op. 7« von Alban Berg, 1923 aus der 1925 von Erich Kleiber an der Berliner Staatsoper uraufgeführten Oper extrahiert. Eine sinnliche, berührende und kühne Musik, ein Stilmix, wie wir ihn von Mahler kennen: »Das Dumpfe und das Hohe, das Banale und das Komplexe liegen viel näher beisammen, als unmittelbar zu erkennen ist« (Georgi). Da hören wir in einem Moment die keck von Soldaten als »schöne Burschen« trällernde Marie und einen absichtsvoll die Scheußlichkeit und Brutalität des Soldatentums darstellenden, schlechten Militärmarsch, der in ein zartes Wiegenlied übergeht, das Marie für ihren unehelichen Sohn singt. Und als seine Eltern gestorben sind, reitet der verwaiste Sohn auf seinem Steckenpferd inmitten spielender Kinder, die »Ringel, Ringel, Rosenkranz« und »hopp, hopp!« singen (der bestens vorbereitete Kinderchor der Staatsoper). Flöten und Celesta lassen die Musik verklingen, die Hilflosigkeit, mit der sich alle, Marie, Wozzeck und die Kinder ihrem Schicksal ergeben, lässt uns frösteln. Eine grandiose Interpretation!
In den 70er und 80er Jahren wurden die Werke von Alfred Schnittke viel gespielt. Sein Freund Gidon Kremer, der 1977 zusammen mit Tatjana Grindenko auch das »Concerto grosso Nr. 1 für zwei Violinen, Cembalo, präpariertes Klavier und Streichorchester« aus der Taufe gehoben hat, war ein eifriger Propagandist Schnittkes. Der prägte selbst den Begriff »Polystilistik« für seine Kompositionstechnik: ein »ästhetisches Programm, ein ernsthafter Versuch, den Teufelskreis der nur noch sich selbst genügenden Avantgardemusik zu durchbrechen« (Georgi). Dieses neoklassizistische Concerto grosso ist eine hochvirtuose, spielfreudige Musik, in der Erez Ofer, RSB-Konzertmeister, und Nadine Contini, die Stimmführerin der Zweiten Violinen des RSB, alle Facetten ihres großen Könnens zeigen dürfen. Wir erleben laut Eigenaussage Schnittkes Filmmusiken, »einen flotten Kinderchoral, eine nostalgisch-atonale Trioserenade, einen garantiert authentischen Corelli (made in UdSSR) und den Lieblingstango meiner Großmutter, gespielt von deren Urgroßmutter auf dem Cembalo«. Ein herrlicher Spaß, in dem die bizarre und endlos anmutende Kadenz der beiden Violinen, ein irgendwie unentschieden endendes Duell auf acht Saiten, zum grandiosen Höhepunkt wird. Bringt mehr Schnittke in den Programmen der Klassik-Institutionen!
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.