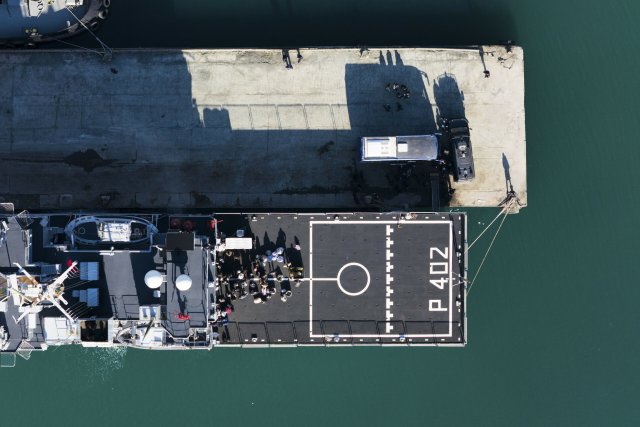- Politik
- »1000 Serpentinen Angst«
»Ich habe mich näher an mich herangeschrieben«
Die Autorin Olivia Wenzel im Gespräch
Wie geht es Ihnen gerade?
Ich bin ein bisschen müde vom vielen Sprechen über das Buch. Ich spreche, spreche, spreche. Selten über die DDR, selten über Theater, immer über Rassismus. Oder anders: Ich freue mich auf die Zeit, in der ich wieder Ruhe zum Schreiben habe, zur Besinnung kommen und die vielen Dinge, die seit März passiert sind, verarbeiten kann. Und damit meine ich nicht nur so erfreuliche Dinge, wie Verkaufszahlen meines Buchs, Rezensionen oder baldige Übersetzungen, sondern auch George Floyd, immer wieder Trump, immer wieder die ertrinkenden Menschen im Mittelmeer, immer wieder die AfD, Corona, Coronaleugner*innen und so weiter.
Hat sich die Art, wie über Ihr Buch gesprochen wird, im letzten halben Jahr verändert?
Nach Erscheinung gab es oft den Versuch, auch anderen Themen aus dem Buch gerecht zu werden, also in Interviews und Besprechungen. Zum Beispiel wurde ich oft zum Thema Angst befragt. Mit der Ermordung von George Floyd und den Black-Lives-Matter-Protesten hat sich der Fokus verengt. Ich habe jetzt manchmal gehört, mein Buch sei das Buch der Stunde. Aber der Rassismus, den ich beschreibe, ist ja kein Trend. Es geht um Kontinuitäten, die sich immer weiter und endlos und scheiße fortsetzen. Dass im Moment Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, vermehrt Aufmerksamkeit für dieses Thema haben, ändert daran erstmal nichts.
Wir müssen also dringend über Rassismus sprechen, gleichzeitig müssen wir aufhören, ausschließlich betroffene Menschen dazu zu befragen. Lesbisch, behindert, Mutter, Schwarz, psychisch krank, ostdeutsch sein - mal sind das gewaltvolle Fremdzuschreibungen, mal ist das Aneignung und Empowerment. Wie denken Sie über Identität nach?
Ich wurde anfangs oft gefragt: Wie ist es, in Deutschland Schwarz zu sein? Aber da habe ich keine Antwort drauf. Ich kann nur erzählen, wie es momentan für mich ist oder wie es mal in meiner Jugend war, bzw. im Roman: wie es sich für meine Protagonistin darstellt. Mir scheint, dass manche denken, dass Schwarz-Sein eine einzelne, konkrete Sache sei. Aber was es in welchem Kontext bedeutet, ist fluid; ich bin ja nicht in jeder Situation meines Lebens vorrangig Schwarz. Oder in jeder Situation meines Lebens Autorin. Ich glaube, Themen rings um Identität und Identitätspolitiken sind in jedem Fall wichtig für mich, auch wenn ich mir damit selbst oft auf die Nerven gehe.
Was bedeutet Ostdeutschsein für Sie?
Das hängt von Zeit und Ort ab. Wäre jetzt das Jahr 1991 und ich wäre weiß, dann wäre mein Ostdeutschsein wahrscheinlich maßgeblich für mich. Ich würde mich bestimmt oft darüber definieren und intensiv damit auseinandersetzen; es wäre identitätspolitisch meine wichtigste Eigenschaft. Im Moment ist Ostdeutschsein aber eher eine schwammige Kategorie für mich: Es ist vor allem angefüllt mit der Art, wie in meiner Familie Erinnerungen ausgewählt, erzählt und wiederholt werden. Eine Grundskepsis dem Kapitalismus gegenüber, das Bewusstsein, eine tatkräftige, selbstständige Frau zu sein, eine Hassliebe zum Thüringer Dialekt - das sind am ehesten die Dinge, die ich als Teil meines Ostdeutschseins benennen könnte.
Sind Sie auch der Identitätsthemen ein bisschen müde?
Ich bin diese Themen absolut leid, aber schon seit ich begonnen habe, an meinem Buch zu schreiben. Gleichzeitig schaffe ich es immer noch nicht, mich ihnen zu entziehen; sie bleiben bis heute zentral. Aber ich weiß auch um andere Sachen, die mich maßgeblich prägen, wie zum Beispiel der Verlust meines Bruders. Wenn er nicht gestorben wäre, hätte ich dieses Buch niemals geschrieben und hätte vielleicht einen anderen Beruf. Ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern, als ich nach seinem Tod an die Uni zurückkam. Da dachte ich: Ich kann mir jetzt keine Management-Seminare mehr reinziehen, die ich oft uninteressant finde. Ab sofort probiere ich nur noch das aus, worauf ich wirklich Bock habe. Manchmal öffnen einem Erfahrungen neue, positive Möglichkeiten, selbst wenn sie an sich extrem negativ sind.
Und worauf haben Sie Bock?
Ich arbeite sehr gerne mit Kindern und mit alten Leuten. Eigentlich sind das die beiden Gruppen, mit denen ich am liebsten in Kontakt kommen möchte.
Wie kommt’s?
Wahrscheinlich weil sie von mir und meiner Lebensrealität am weitesten entfernt sind. Für das Theaterstück »Die Erfindung der Gertraud Stock«, das ich gemeinsam mit dem Kollektiv vorschlag:hammer gemacht habe, haben wir Interviews mit alten Frauen geführt und diese dann zu einer Biografie verdichtet. In diesen Gesprächen ging es viel um die Nachkriegszeit. Das sind Geschichten, die sonst verschüttgehen würden, sowas interessiert mich.
Und die Kinder?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Kinder einen geilen Humor haben, und ich liebe ihre Direktheit und Ehrlichkeit.
Gibt es einen Moment, der Ihr künstlerisches Schaffen geprägt hat?
Ich glaube, vor ungefähr acht Jahren hat mich Julia Wissert kontaktiert. Sie war damals schon sehr politisiert, hat ihre Abschlussarbeit an der Uni über strukturellen Rassismus am Theater geschrieben. Dazu wollte sie mich interviewen. Ich hab gemeint: Ich sehe mich überhaupt nicht als Schwarze Theatermacherin, ich bin Theatermacherin. Ich hatte einfach überhaupt keine Lust auf diese Schublade. Und dann dachte ich: Woher dieser große Widerstand? Vielleicht sollte ich mir über den mal Gedanken machen ... Das habe ich Julia Wissert geschrieben. Und daraus ist ein ganz schöner und langer E-Mail-Austausch entstanden. Heute denke ich, dass mit diesem Austausch vieles anfing. Da bin ich auf jeden Fall anders herausgekommen, als ich hineingegangen bin.
Was hat da angefangen?
Ich würde sagen, ich habe mich über die Jahre immer näher an mich selbst herangeschrieben. Ich bin wirklich weit entfernt gestartet.
Weit entfernt von Ihnen selbst?
Also weit weg von Sachen, die mich sehr berühren oder die mit mir zu tun haben. In einem alten Text von mir geht es zum Beispiel um Leute, die in einem Elektrofachhandel unsterblich werden. Das waren Sachen, die mir mega Spaß gemacht haben und in die ich mich gerne reingedacht habe. Aber es waren auch alles Themen, von denen ich persönlich nicht betroffen war.
Mit Ihrem jetzigen Buch ist das anders. Es ist autofiktional. Das heißt, es hat autobiografische Züge, enthält aber auch fiktionale Geschichten. Haben die Leute gerade vermehrt Lust auf Authentizität?
Das, was wir für Authentizität halten, interessiert Leute immer, auf jeden Fall. Dass mein Buch auch einen gewissen Voyeurismus befriedigt, ist mir klar, aber irgendwie auch egal. Oder anders: Ich gehe davon aus, dass sich in meiner Biografie und in den Biografien von Menschen rings um mich einiges ballt, das erzählenswert ist und das ich wirklich und grundsätzlich anderen Menschen mitteilen will, also auch im Sinne von teilen. Dafür ist und war dieses Buch die bestmögliche Form.
Es fällt Ihnen also gar nicht schwer, mit der eigenen - teilweise schmerzhaften - Geschichte sichtbar zu sein?
Jetzt lese ich manchmal Passagen vor, von denen ich weiß, als ich sie geschrieben habe, saß ich heulend am Schreibtisch. Doch je länger ich damit in der Öffentlichkeit stehe, desto weniger nah sind sie mir. Irgendwie ist das gut und heilsam, und doch weiß ich nicht, ob ich das noch mal so erleben möchte. Also dass einem die eigenen Erfahrungen immer fremder werden. Dass sie jetzt irgendwie nicht mehr nur meine sind.
Nehmen Sie sonst noch was mit für kommenden Projekte?
Mir ist erst ziemlich spät aufgegangen, dass mein Buch auch den Versuch unternimmt, Rassismuserfahrungen an Nicht-Betroffene zu vermitteln. Und damit unbewusst - mal wieder - eher von einem weißen, als von einem Schwarzen Publikum ausgeht. Aber eigentlich ist meine Frage im Moment nicht, wie kriege ich es bei meinem nächsten Buch hin, mir unbewusst ein Schwarzes Publikum vorzustellen oder Menschen mit Behinderungen usw. Sondern eher: Wie kriege ich es hin, dass ich erst mal an niemand anderen denke? Und auch nicht an die Mechanismen des Literaturbetriebs, die ich ja im Moment immer genauer kennenlerne. Und ich überlege öfter, wie ich nicht nur die Präsentation meines Buchs, also Lesungen usw., sondern auch das Schreiben an sich kollektiver gestalten kann.
Interview: Esther Schelander
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.