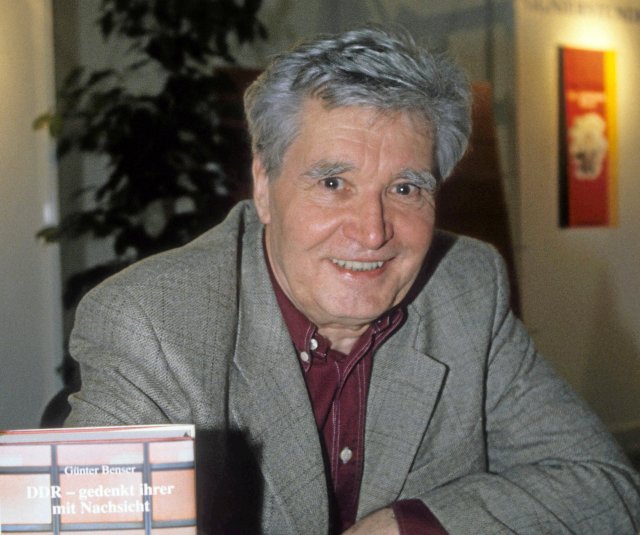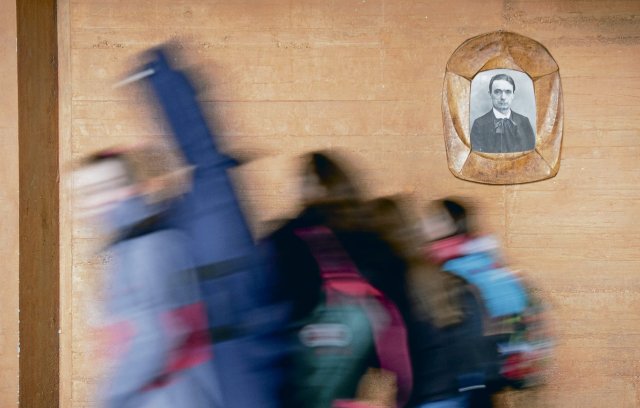- Kultur
- »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui«
Gangsterposse gegen den Faschismus
Deutsch-russische Annäherung im Theater: Bertolt Brechts »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui« in Moskau
In Zeiten anhaltender Entfremdungen zwischen Russland und Deutschland können schon bescheidene, künstlerische Zeichen etwas Hoffnung auf Besserung durch Annäherung geben. Zwei sehr unterschiedliche Beispiele: Der Moskauer Regisseur Kirill Serebrennikow inszenierte im vergangenen Jahr am Berliner Deutschen Theater »Decamerone« nach Giovanni Boccaccio, eine Koproduktion mit dem Gogol-Center Moskau, das Serebrennikow leitet. Corona verhinderte eine größere Aufmerksamkeit in Deutschland. Kürzlich lief die Ausstellung »Die Eisenzeit. Europa ohne Grenzen. Das erste Jahrtausend vor Christus« in der St. Petersburger Eremitage. Dieses wissenschaftliche Großprojekt gestalteten die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Eremitage gemeinsam, der jüngste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen großen Museen in Russland und Deutschland. Die Ausstellung ist in Deutschland nicht wahrgenommen worden.
Umgekehrt kann bedeutsam werden, dass ein deutscher Künstler in Moskau arbeitet: Der deutsche Regisseur Siegfried Kühn inszenierte kürzlich Brechts Parabelstück »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui« am berühmten Moskauer Taganka-Theater, wo es vor Publikum gezeigt werden kann. Das Drama gilt als weitsichtiges Gleichnis über Faschismus, Kapitalismus und Machtmissbrauch. Anschaulich und grotesk zeigte Brecht in seiner Gangsterposse (1941) Hitlers Aufstieg als Ergebnis von Mechanismen zwischen Kriminalität und Machtstreben. Brechts Theater arbeitete mit grellen Effekten und Verzerrungen, mit dem ganzen Instrumentarium seines epischen Theaters.
Kühn verwendet die Übersetzung von Efim Etkind, der viele Stücke Brechts ins Russische übertragen hat. Er variiert einige Texte zugunsten der Kriminalisierung. Ebenso großzügig und locker borgt er sich Musikfetzen aus Verdi- und Mascagni-Opern. Kühn nimmt auch Anleihen von anderswo auf: bei den Filmen Federico Fellinis, bei Fritz Langs Stummfilm »Metropolis«, bei der legendären »Arturo Ui«-Inszenierung des Berliner Ensembles (1959, Manfred Wekwerth/Peter Palitzsch). Das lockert die ansonsten grelle, laute Show auf, bei der auch viel geschrien wird.
Kühn setzt auf Klischees und Masken: viel schwarze Kostüme und noch mehr schwarze Schminke - dick umrandete Augenhöhlen beispielsweise, die das Grimassieren befördern und das Grotesk-Gespenstische der Figuren steigern. Dazu passt das Bühnenbild (Boris Blank): ganz aus Metall, zusammengeschraubt wie aus dem Stabilbaukasten, zwei Spielpodeste weit oben links und rechts, in der Mitte eine riesige Treppe, die an ein Moloch-Maul erinnert und auch entsprechend bespielt wird. Ein pausenloses, temporeiches Rauf und Runter, eine hechelnde Gymnastik, meist mit grellem Neonlicht ausgeleuchtet (selten mit Farben). So kommt eine laute, angreifende Aufführung zustande, die mit viel Applaus bedacht wurde und wird.
Zu Brechts berühmtem und oft zitiertem Stückschluss »Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch« verbiegt Hauptdarsteller Alexej Finajew-Nikolotow seine Ui-Figur zum Hakenkreuz (wie es Martin Wuttke in Heiner Müllers »Arturo Ui«-Inszenierung von 1995 am Berliner Ensemble gezeigt hatte), ein überwältigendes Symbol.
Der Impuls für die Regiearbeit Kühns in Moskau hat auf andere Weise mit dem Verhältnis zwischen Russen und Deutschen zu tun: Der junge Kühn studierte 1959 bis 1964 an der berühmten Moskauer Filmhochschule WGIK und freundete sich dort mit dem Schauspielstudenten Nikolaj Gubenko an. Mit einer Aufführung von »Arturo Ui«, ihrem gemeinsamen Diplom, gastierten sie erfolgreich in der ganzen Sowjetunion. Gubenko entwickelte sich zu einem bedeutenden Charakterdarsteller des sowjetischen Kinos, sein Film »Mit gebrochenen Schwingen« (1977) machte ihn auch in Deutschland bekannt. Kühn drehte bei der Defa rund ein Dutzend Spielfilme. Ein halbes Leben später lud Gubenko seinen Freund zu einer neuen »Arturo Ui«-Arbeit ein, eben am Taganka-Theater. Während der Arbeit gab Gubenko zu erkennen, dass in seinem Film »Mit gebrochenen Schwingen« auch Schicksale seiner Familie, besonders seiner Mutter, eingeflossen seien, Erlebnisse während der Okkupation durch die deutsche Wehrmacht. Das wundert nicht, denn jede zweite russische Familie hat Opfer im Krieg zu beklagen. Der Zusammenhang zwischen Gubenkos Familienschicksalen und Brechts »Arturo Ui« ist vertrackt, aber nachvollziehbar.
Jeder weiß, wohin die »Arturo Ui«-Story historisch geführt hat. Aber wohin führt sie russische Zuschauer heute? Und schließlich: Ein Gastspiel der Aufführung in Deutschland wäre kein schlechter Beitrag zur Verbesserung der internationalen Beziehungen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.