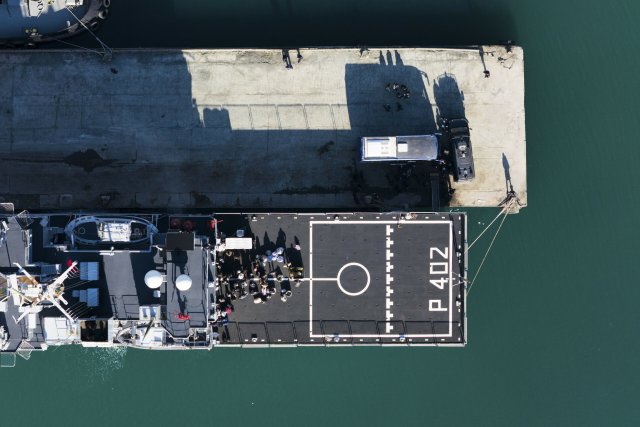- Politik
- Erinnerungspolitik
Das Grauen vor der eigenen Haustür
Stele erinnert in Leipzig an Ex-Zwangsarbeiterlager – vor einer Immobilie, die heute einem Rechtsextremen gehört

Das Gedenken ist noch immer nicht bei allen erwünscht. Am Dienstag wurde in der Kamenzer Straße in Leipzig eine schlanke Stele enthüllt, die an ein Außenlager des KZ Buchenwald erinnert. Tags zuvor war sie in den Boden eingelassen worden. Noch bevor die ersten Besucher die Texte und Bilder zu Gesicht bekamen, auf denen über die gnadenlose Ausbeutung von vorwiegend weiblichen KZ-Härtlingen in einem örtlichen Rüstungsbetrieb informiert wird, war sie bereits beschädigt worden: »Auf der Rückseite wurde die Stele zerkratzt«, sagt Anja Kruse.
Kruse ist Mitarbeiterin einer Gedenkstätte in Leipzig, die seit zwei Jahrzehnten an die Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie der NS-Zeit erinnert. In der Stadt war mit der Hugo Schneider AG (HASAG) der größte derartige Konzern in Sachsen ansässig. Das Unternehmen stellte unter anderem Panzerfäuste her. Als im Laufe des Krieges heimische Arbeitskräfte zu fehlen begannen, weil die Männer an der Front waren, wurden bei der HASAG wie in anderen Rüstungsbetrieben Häftlinge aus den Konzentrationslagern ausgebeutet: im Fall des Leipziger Unternehmens zunächst in Werken im besetzten Polen, später auch in Leipzig und Umgebung. Dort schufteten 14 500 Häftlinge für den Konzern. Allein 5000 Frauen waren in Fabrikgebäuden und Baracken in der heutigen Kamenzer Straße untergebracht. Es war das größte Frauen-Außenlager des KZ Buchenwald, sagt Jens-Christian Wagner, Direktor der dortigen Gedenkstättenstiftung.
Zwangsarbeiter waren ab 1943 in deutschen Städten allgegenwärtig. Ihre Ausbeutung, die nicht selten in körperlicher Zerrüttung und Krankheit endete und eine »Einbahnstraße in den Tod« gewesen sei, war »ein öffentliches Verbrechen«, sagt Wagner und verweist auf über 1000 KZ-Außenlager in oder bei Rüstungsbetrieben im Dritten Reich. Niemand konnte später behaupten, nichts davon bemerkt zu haben: »Das Grauen fand vor der eigenen Haustür statt.« Viele Zwangsarbeiter hätten nach dem Krieg berichtet, Misshandlungen im Alltag ausgesetzt gewesen zu sein, von Kollegen oder Anwohnern.
In Leipzig sind dank der Arbeit der Gedenkstätte, ihrer Publikationen und Stadtrundgänge heute viele Orte bekannt, an denen KZ-Häftlinge untergebracht waren. Die Gebäude sind aber nirgends erhalten – außer in der Kamenzer Straße 12. Dort steht ein zweistöckiger Bau mit blassrosa umrahmten Fenstern, dessen hohe Räume für die Zwangsarbeiterinnen als Schlafsäle hergerichtet wurden und in dem sich auch eine Krankenstation und ein Speisesaal befanden. Es sei »das einzige heute noch erhaltene bauliche Relikt« eines KZ-Außenlagers in der Stadt, sagt Kruse – ein authentischer Ort, an dem ein »würdiges und lebendiges Gedenken« stattfinden müsse.
Das freilich war bisher schwierig. Eine erste Gedenktafel, von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) im Jahr 2009 angebracht, wurde regelmäßig beschädigt und verschwand schließlich ganz. Mit der neuen, auf Beschluss der Stadt errichteten Stele unternehme man »den zweiten Versuch, diesen Ort des Unrechts und des Leids zu markieren«, sagt Leipzigs SPD-Oberbürgermeister Burkhard Jung. Schwerer wiegen freilich die äußerst problematischen Besitzverhältnisse bei dem eigentlichen historischen Gebäude. »Die Immobilie ist in der Hand eines einschlägigen Neonazis«, sagt Jung. In dem Haus fanden schon Rechtsrock-Konzerte statt; auch ein Fitnessstudio, in dem rechte Kampfsportler trainieren, ist dort ansässig. Dem Rechtsextremen gehört auch die Fläche vor dem Gebäude, weswegen die Stele etwa hundert Meter die Straße hinunter auf einer städtischen Fläche aufgestellt werden musste. Sie steht nun vor einem Plattenbau aus DDR-Zeiten, in dessen ungeputzten Fenstern für die Vermietung von Lagerräumen geworben wird.
Die derzeitige Nutzung des einstigen Zwangsarbeiterinnenlagers empfinden viele als Zumutung. »Für einen historisch-authentischen Ort ist das ein Desaster«, räumt der Rathauschef ein und nennt die Situation »unerträglich und im Grunde nicht hinnehmbar«. Auch Wagner mahnt, zum verantwortungsbewussten Umgang mit der Geschichte gehöre es, dass ein solcher Ort »nicht von einem Rechtsextremisten genutzt wird«. Alle Versuche, das zu ändern, sind bisher freilich gescheitert. Zwar drängte der Stadtrat die Verwaltung per Beschluss zum Handeln. Gerade beschäftigt das Thema erneut die Ausschüsse, nachdem die Gedenkstätte mit einer öffentlichen Erklärung den Druck erhöht hatte. Die Nutzung des früheren KZ-Geländes durch einen Neonazi sei »ein Skandal und bagatellisiert das Leid der dort inhaftierten Gefangenen«, hieß es in dem von mehr als tausend Menschen unterschriebenen Papier.
Doch Erfolg hatten die Bemühungen nicht. 2020 wies die obere Denkmalbehörde einen Antrag ab, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Die damit verbundene Hoffnung war, dass hohe Auflagen den Eigentümer vertreiben könnten. Die Behörde lehnte ab »mangels Originalität der Substanz«, sagt Jung: »Wir sind damit nicht einverstanden.« Auch ein Kauf der Immobilie durch die Stadt oder andere Interessenten kam bisher nicht zustande. Der »Spiegel« berichtete Anfang 2022, der Besitzer verlange »Fantasiepreise«; die Rede war von zehn Millionen Euro, obwohl der Verkehrswert im niedrigen siebenstelligen Bereich liege. Jung gestand bei Einweihung der Stele, die Vorstellung falle »ungeheuer schwer«, dass ein Nazi mit öffentlichen Geldern aus der Immobilie herausgekauft wird. So gibt es vorerst keinen Gedenkort in dem Gebäude, aber immerhin die Stele – und die Hoffnung, dass sie jenseits des Kratzers keinen ernsthafteren Beschädigungen ausgesetzt sein wird.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.