- Kultur
- Gendersensible Medizin
Medizinischer Männerblick
Nicht erst seit Corona sind Frauen überdurchschnittlich von Erschöpfungskrankheiten betroffen. Aber es mangelt an gendersensibler Forschung
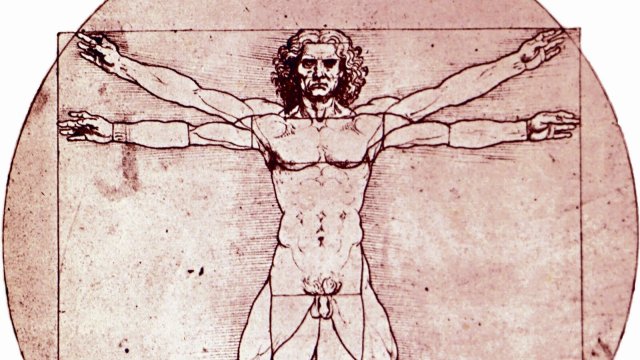
Ein Report der Allgemeinen Ortskrankenkasse hat die Fehlzeiten seiner gut 14 Millionen Mitglieder im Zeitraum von März bis Juli 2022 untersucht. Der AOK-Bericht differenziert die Krankmeldungen nach Berufsgruppen: Beschäftigte in der Kinderbetreuung waren mit 28 315 Erkrankten je 100 000 Versicherten am häufigsten betroffen, an zweiter Stelle folgen medizinische Fachangestellte mit 25 849 Gemeldeten. Im Baugewerbe (5809) und erst recht in der Landwirtschaft (3599) liegen die Werte dagegen deutlich niedriger.
Besonders stark gewachsen ist zuletzt die Zahl der Atemwegserkrankungen. Rund vier von fünf Fehlzeiten-Anzeigen waren dabei auf den Nachweis einer Ansteckung mit dem Coronavirus zurückzuführen. Diese Quote gilt für alle Beschäftigten unabhängig von ihrem beruflichen Umfeld. Die AOK-Studie belässt es bei der Präsentation ihrer statistischen Daten, sie interpretiert die Erkenntnisse nicht. Doch der geschlechtsspezifische Befund ist offensichtlich: Die ganz überwiegend weiblichen Mitarbeiterinnen in Erziehung und Pflege hatten während der Pandemie im Vergleich zu Beschäftigten in klassischen Männerberufen ein mehr als dreimal so hohes Infektionsrisiko.
Diagnosen im Konjunktiv
Auch bei den Spätfolgen der Pandemie zeigt sich ein klares Gefälle. Frauen leiden überdurchschnittlich an Long-Covid, Post-Covid und der verwandten Erschöpfungserkrankung CFS, der Abkürzung für »Chronisches Fatigue-Syndrom«. Von dieser Müdigkeit sind in Deutschland nach Schätzungen bis zu 250 000 und weltweit rund 17 Millionen Menschen betroffen.
CFS wirkt sich als grundlegende Schwäche auf das körperliche, geistige und psychische Wohlbefinden aus. Typische Anzeichen sind Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, manchmal auch Depressionen, Angstzustände und Schlafstörungen. Die Mehrheit ihrer Patient*innen sei weiblich, bestätigt Carmen Scheibenbogen, die an der Berliner Charité schon vor der Coronakrise ein bundesweit wegweisendes Zentrum zur Behandlung von CFS aufgebaut hat. Es handele sich um eine Immunerkrankung, für die Frauen nach einer Infektion offenbar anfälliger seien. Es gebe Anzeichen dafür, dass das körperliche Schutzsystem dann überaktiv reagiere, dass Autoantikörper eine Rolle spielten und das autonome Nervensystem gestört sei. Die diffuse Vielfalt der Symptome mache es aber oft schwierig, eindeutige Diagnosen zu stellen.
Die vorsichtige Sprache der Wissenschaftlerin im Konjunktiv ist kein Zufall. Denn die Datenlage ist äußerst dünn, die Forschung zum CFS steckt noch in den Kinderschuhen. Nicht hinreichend belegt ist zum Beispiel, ob sich die Ursachen des Phänomens überhaupt auf rein medizinischer Basis erklären lassen. Aktuelle Bestandsaufnahmen wie der AOK-Fehlzeitenreport legen eine andere, eher soziologische Interpretation nahe: Vielleicht erkranken Frauen gar nicht aus biologischen Gründen häufiger, sondern weil sie in Berufen mit vielen menschlichen Kontakten tätig sind und während der Pandemie bei der Bewältigung der psychosozialen Folgen besonders belastet waren.
Priorität Geburtsprävention
Das Erschöpfungssyndrom hat die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits 1969 als neurologische Krankheit anerkannt, wissenschaftliche Arbeiten dazu aber gab es seither nur wenige. Das belegt, welch geringe Bedeutung die Kategorie Gender im Feld der Medizin lange Zeit hatte. Dabei gibt es durchaus erhebliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern; sie betreffen die Diagnose, die Behandlungsmethoden, die Nachsorge und die Gesundheitsprävention.
Hier kannten die Krankenkassen über Jahrzehnte nur an einem Punkt einen genderspezifischen Zugang: Die Vorsorge gegen Brustkrebs und die gründliche Untersuchung des weiblichen Unterleibs galten stets als besonders wichtig und förderungswürdig. Die von kritischen Wissenschaftlerinnen wie der US-amerikanischen Herzspezialistin Nanette Wenger ironisch »Bikini-Blick« genannte einseitige Konzentration auf Brüste und Gebärmutter fand ihre Begründung darin, dass diese Organe als entscheidend für die biologische Reproduktion der Gesellschaft angesehen werden. In der diagnostischen Praxis wie auch in der Ausbildung des medizinischen Nachwuchses aber erklärte man ungebrochen den männlichen Körper zur Norm.
Im Umfeld der Auseinandersetzungen um den Abtreibungsparagrafen 218 entstand in (West-)Deutschland ab den 1970er Jahren eine Frauengesundheitsbewegung. Die dort aktiven Feministinnen skandalisierten, dass Testreihen zu Medikamenten häufig nur mit männlichen Probanden durchgeführt wurden. Die damals noch vorwiegend männliche Ärzteschaft ignorierte spezifisch weibliche Symptomatiken. So unterscheiden sich die Anzeichen von Herz- und Kreislauferkrankungen nach Geschlecht: Männer spüren wie im klassischen Lehrbuch Engegefühle und plötzliches Stechen in der Brust; Frauen klagen eher über Kiefer- und Nackenschmerzen, Atemnot oder Übelkeit. Ein möglicher Infarkt wird daher bei ihnen oft zu spät erkannt.
Engagierte Fraueninitiativen haben einst dafür gesorgt, dass sich der geschlechtssensible Blick auf die Medizin langsam schärfte. Es entstanden regionale Selbsthilfezentren und eine spezielle Gesundheitsberichterstattung aus weiblicher Perspektive, die bald auch von öffentlichen Institutionen finanziell unterstützt wurde. Doch noch immer werden vor allem unerklärte Krankheiten und psychische Störungen, über die vor allem Frauen klagen, nicht ernst genommen, als Hypochondertum abgetan oder ganz ignoriert. Das zeigt sich nun erneut in der Debatte um die Langzeitfolgen von Corona-Infektionen. Denn auch hier sind nach Schätzungen der WHO drei Viertel der Betroffenen weiblich.
Patientenstereotyp Mann
Im Gegensatz zu anderen Diagnosen wie etwa »Multiple Sklerose« gibt es beim CFS bisher kaum Therapiekonzepte und erst recht keine zugelassenen Medikamente. Unter Fachleuten ist umstritten, ob es sich um eine körperliche oder um eine »sozial konstruierte«, also zum Beispiel berufsbedingte Erkrankung handelt. Das lange vernachlässigte Thema hat es mittlerweile bis in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung geschafft. Zehn Millionen Euro hat die Ampel dafür in den kommenden Jahren eingeplant.
Die Medizin als akademisches Fach ist keine männerdominierte Angelegenheit mehr. Vorbei sind die Zeiten, als sogenannte »Halbgötter in Weiß« die morgendlichen Visiten und erst recht die Operationssäle in den Kliniken prägten. Frauen leisteten lediglich Hilfsdienste, assistierten als Krankenpflegerinnen. Die pharmazeutische Industrie agierte geschlechtsblind und erprobte Arzneimittel nur am Patientenstereotyp Mann – was für Frauen bisweilen lebensbedrohliche Folgen haben konnte. Inzwischen gibt es deutlich mehr Ärztinnen als früher, das Fach Medizin wählen an den Hochschulen heute zu zwei Dritteln weibliche Studierende. Die Entwicklung einer geschlechtersensiblen Medizin aber steht immer noch am Anfang.
Zu den wichtigsten Forschungslücken gehört die Verknüpfung der Kategorien Gender und Klasse, die in den Sozialwissenschaften etwa mit dem Konzept »Intersektionalität« gefasst werden soll. Die Versuche, solche Zusammenhänge zu denken, sollten daher beide Geschlechter in den Blick nehmen. So haben männliche Arbeiter, die unter Tage, im Stahlwerk oder auf dem Bau geschuftet haben, eine nachweisbar verkürzte Lebenserwartung. Umgekehrt ist das überwiegend weibliche Personal in Kindertagesstätten oder Pflegeeinrichtungen offenbar besonders stark von Erschöpfungskrankheiten betroffen – vorrangig nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie belastende Berufe ausüben und dafür auch noch schlecht bezahlt werden.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







