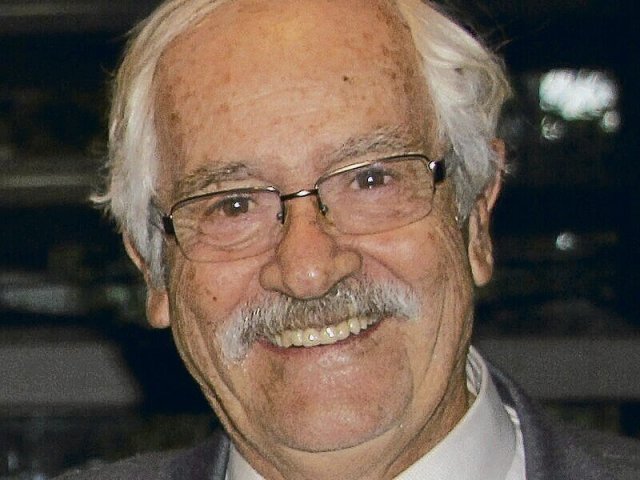- Kommentare
- Kapitalismus
Freund Kapitalismus hat Symptome
Bildung, Gesundheitsversorgung und nun auch die WM in Katar: Dem Kapitalismus geht es gar nicht gut, meint Christoph Ruf

Auch im Profifußball gibt es kein gutes Leben im falschen – das war der Tenor einer extrem netten Veranstaltung zum Thema Katar, die ich moderieren durfte. Heißt: So lange einem nichts Besseres als Kapitalismus als Rahmen für das Große und Ganze einfällt, kann man nur versuchen, die Exzesse abzumildern und den ganzen Zirkus etwas humaner, diverser und verantwortlicher zu machen. Ich sehe das anders, habe aber auch leicht reden, weil ich nicht Fan eines Vereins bin, der in der Bundesliga oder Schlimmerem sein Unwesen treibt. Ein Satz aus den Gesprächen, die bei solchen Veranstaltungen stets einsetzen, wenn die Mikrofone aus und der Zapfhahn an sind, hallte dann aber jedenfalls nach: Der Sozialismus, so sagte ein Kollege ein wenig bedauernd, sei ja nun mal als Alternative zu dem ganzen Mist gescheitert.
Das ließ ich erst mal so stehen, ich wusste ja, was gemeint war: Honecker, Ceaușescu, die Ost-CDU, alle gescheitert. Und nicht wirklich schade drum. Dass in absehbarer Zeit ein globales System entsteht, das Profitgier und Ellenbogen als private und wirtschaftliche Maximen ersetzt, halte ich auch nicht für sonderlich wahrscheinlich. Für ganz sicher halte ich es aber, dass der Neoliberalismus keine der gegenwärtigen Krisen in den Griff bekommt. Eher übernimmt Elon Musk ganze Staaten (auch offiziell, meine ich), als dass der Kapitalismus die Gründe für Armutsmigration oder für die ökologische Lage beseitigt. Er müsste dem Problem an die Wurzel gehen. Und die ist er selbst.
Interessanter als Sozialismusdebatten finde ich deshalb die Beobachtung, dass es um Freund Kapitalismus gerade gar nicht gut steht. Wäre er ein Mensch, würde man ihn nach kurzer ärztlicher Untersuchung in die nächste Klinik schicken. Und ihn so schnell nicht wieder entlassen.
Die Krankheitssymptome sind offensichtlich, weltweit fast überall. Und hier sowieso. In den Zeiten, in denen das »sozial« vor »Marktwirtschaft« noch kein Hohn war, sorgte er in Westdeutschland zumindest auf den ersten Blick für ein funktionierendes Gemeinwesen. Auch mit einem kleinen bis mittleren Einkommen kam eine vierköpfige Familie gut klar. Wer krank war, wurde in der Regel ohne weitere Kosten behandelt. Lange her. Überhaupt wird der Staat gerade an erstaunlich vielen Stellen dysfunktional: Vom Unterrichtsausfall bis zur Post, die oft nur noch einmal die Woche kommt, und den Kliniken, die ganze Abteilungen schließen müssen. Es fehlt an Personal und Medikamenten. Nicht lieferbar sind beispielsweise einige Krebstherapiepräparate, viele Frauen können ihre Behandlung gegen Brustkrebs nicht wie vorgeschrieben fortsetzen. Derzeit fehlen fiebersenkende Mittel, vor allem solche für Kinder.
Die Medikamente werden teils einfach nicht mehr hergestellt, weil die Gewinnmargen gesunken sind. Teils entstehen die Engpässe aber auch, weil einzelne Wirkstoffe nur noch in einem einzigen Werk weltweit produziert werden. Das wirft die Frage auf, ob eins der größten Heilsversprechen des Kapitalismus nicht allmählich für zu viele Krisen verantwortlich ist. Jeder stellt das her, was er am besten kann, so die Theorie. Die Praxis ist, dass zu minimalen Kosten produziert werden soll. Umwelt- und Sozialstandards sind da eher lästig.
Der olle Marx, aber das ist nun wirklich keine sehr originelle Feststellung, war als Analytiker brillant. Dass der Kapitalismus an sich selbst zu Grunde geht, hat er vorausgesehen. Nicht ganz so gut war hingegen die Prognose, dass die Widerstandskräfte mit den Krisensymptomen wachsen würden. Dass es mal weit besseres »Opium des Volkes« als die dusselige Religion geben würde – mit »TikTok« und »Insta« hat der alte Zausel halt nicht gerechnet. Wenn man ihn heute fragen könnte, ob der Sozialismus denn wirklich gescheitert sei, hätte er allerdings ziemlich sicher eine Antwort parat. Woher ausgerechnet er das wissen solle, würde er fragen. Der Sozialismus sei ja noch nie ausprobiert worden.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.