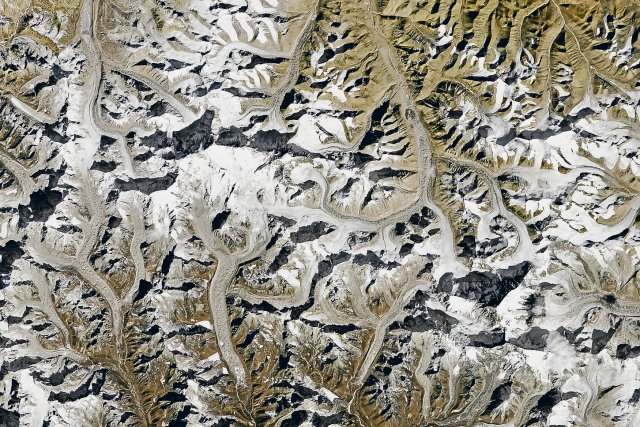- Wissen
- Landwirtschaft
Gentechnik ohne Risikoprüfung
EU-Kommission setzt bei der Pflanzenzüchtung auf Technologieoffenheit anstatt auf das Vorsorgeprinzip

Am 5. Juli wurde ein Gesetzesvorschlag von der Europäischen Kommission zur Anpassung des Umgangs mit Pflanzen bekanntgegeben, die durch Neue Genomische Techniken (NGT) entwickelt wurden. Bisher geltende strenge Regeln würden damit außer Kraft gesetzt, da mit bestimmten Methoden erzeugte Pflanzen nicht mehr als gentechnisch veränderte Organismen (GVO) gelten würden.
Während Wissenschaftsinstitutionen wie das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) die Aufweichung des bestehenden Gentechnikrechts begrüßen, sehen Kritiker*innen darin eine lang befürchtete Deregulierung – mit allen Konsequenzen. NGT, auch als Genome Editing bezeichnet, ist ein Überbegriff für eine Vielzahl biotechnologischer Methoden wie zum Beispiel Crispr oder Talen, die das Erbgut eines Organismus verändern können und seit der Verabschiedung der bestehenden GVO-Gesetzgebung 2001 entwickelt wurden. NGT-Pflanzen und -Produkte fallen zurzeit unter ebendiese Gesetzgebung, was dem Wortlaut der Kommission zufolge »das Potenzial zur Bewältigung aktueller Herausforderungen im Agrar- und Ernährungssystem« dieser Technologie hemmt. Umweltorganisationen wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) kritisieren, dass der Entwurf nicht ausreichend auf die Bedenken von Landwirt*innen, Züchter*innen und Verbraucher*innen eingehe und dabei auf alten Versprechen von Nachhaltigkeit und Ertragssteigerungen beharre, die sich bereits bei der alten Gentechnik nicht bewährt hätten.
Umstrittene Definition von Präzision
Die drastischen Vorkehrungen, die zur Deregulierung von NGT beitragen sollen, kamen nicht überraschend, eine inoffizielle Veröffentlichung des Entwurfs kündigte schon vor wenigen Wochen die technologieoffene Haltung der Kommission an. Am deutlichsten sind NGT-Pflanzen und -Produkte betroffen, deren eigene DNA durch gentechnische Eingriffe verändert wurde, ohne dabei Fremd-DNA einzuführen und die »natürlich vorkommen oder durch konventionelle Züchtung erzeugt werden könnten«. Diese Pflanzen müssten nicht mehr als Gentechnik reguliert werden – das heißt, sie könnten ohne Risikoprüfung angebaut werden und ohne entsprechende Kennzeichnung auf dem Markt landen. Unter diese Kategorie dürften nur Pflanzen fallen, an denen nicht mehr als 20 genetische Veränderungen im Erbgut unternommen wurden. NGT könnten eingesetzt werden, um Nukleotide (die Grundbausteine der DNA) einzufügen, auszutauschen und um eine beliebige Anzahl davon zu entfernen. »Es gibt keine belastbaren wissenschaftlichen Belege oder Begründungen für eine willkürliche Grenze von 20 Nukleotiden«, sagt Angelika Hilbeck, Wissenschaftlerin am Institut für Integrative Biologie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ). »Der Kontext ist entscheidend dafür, welche genbeeinflussten Veränderungen zu welchen Konsequenzen führen«, erklärt die Agrarökologin. Diese Klassifizierung würde eine unvorhersehbare Bandbreite an NGT-Pflanzen ergeben, die von gezüchteten Pflanzen substantiell verschieden wären und trotzdem den gleichen Regularien unterlägen.
Der Hintergrund dieses Vorschlags basiert auf der Annahme, dass NGT mit höherer Präzision Veränderungen im Erbgut erzielen als konventionelle Züchtungen, die auf Methoden der zufälligen Mutagenese zurückgreifen. Dadurch soll eine geringere Anzahl an unerwünschten genetischen Modifikationen entstehen. Prinzipiell stimmt der Gedanke – er ist aber nicht bis zum Ende gedacht. »Auch geringfügige genetische Veränderungen können große Auswirkungen haben«, erläutert Margret Engelhard vom Bundesamt für Naturschutz. »Darüber hinaus sind mögliche Risiken zukünftiger Produkte und Pflanzeneigenschaften heute noch nicht absehbar und werden auch bei den heute verfügbaren Pflanzen erst im Anbau umfassend sichtbar werden.« Die hohe Zielgenauigkeit ermöglicht es NGT, geschützte Bereiche im Genom zu verändern, die durch natürliche oder chemische Mutagenese nicht erreichbar wären. Sogenannte Off-target-Effekte in diesen Bereichen könnten weitreichendere Folgen für die Funktionalität des Organismus haben – und bei Auskreuzungen von Nutzpflanzen mit Wildpflanzen eben auch für diese.
Abgesehen davon führen NGT meist zu DNA-Doppelstrangbrüchen anstelle von einzelnen Punktmutationen, wie sie in der konventionellen Züchtung hervorgerufen werden. Bei einer fehlerhaften Reparatur können in einzelnen Fällen die losen Enden der DNA nicht wieder zusammengefügt oder mit anderen Abschnitten verbunden werden. Dieser als »Chromothripsis-like« bezeichnete Effekt wurde vor kurzem in Crispr-Experimenten mit Pflanzengenomen von Wissenschaftler*innen der Cornell-Universität in den USA und dem Weizmann Institute of Science aus Israel in einer bislang nur als Preprint veröffentlichten Studie beschrieben. Solche Beispiele zeigen, dass die kurze Zeitspanne von knapp zehn Jahren, in denen Crispr in der Anwendung ist, nicht ausreichen, um das Verfahren von einer Risikoabschätzung zu befreien.
Mängel in der Folgenabschätzung
Die Fahrlässigkeit, mit der die EU-Kommission die Risiken dieser Technologie herunterspielt, kommt für Kritiker*innen nicht überraschend. Schon vor einem Jahr wurde im Auftrag des Bundesamts für Naturschutz eine EU-Studie unter die Lupe genommen, die als Grundlage für den Gesetzentwurf dient. Das Urteil war deutlich: »Obwohl das Dokument den Anspruch erhebt, eine ›Studie‹ zu sein, handelt es sich dabei lediglich um eine Zusammenfassung willkürlich ausgewählter Materialien und eine intransparente Stakeholder-Befragung.« Hervorgehoben wurde, dass das Vorsorgeprinzip, ein Kernaspekt der europäischen Umwelt- und Gesundheitspolitik, untergraben werde. Das Prinzip sieht vor, dass potenzielle Schäden für die menschliche Gesundheit und die Umwelt im Voraus weitestgehend vermieden werden. Besteht nicht ausreichend wissenschaftliche Evidenz für die Harmlosigkeit einer Risikotechnologie, darf sie nicht eingesetzt werden, bis eine bessere Datenlage existiert. Laut Gutachten ist dies bei NGT der Fall.
Die EU-Kommission ignorierte auch Bedenken aus dem eigenen Lager. So stellte der Ausschuss für Regulierungskontrolle der EU-Kommission fest, die Folgeabschätzung des Gesetzesentwurfs »weise erhebliche Mängel auf«. Diese bezogen sich unter anderem auf eine unzureichende Evaluation der Konsequenzen für die ökologische und gentechnikfreie Lebensmittelbranche. Der Gesetzentwurf sieht nämlich vor, dass die Rückverfolgbarkeit von NGT-Pflanzen nicht mehr gewährleistet sein muss. Das heißt, dass es nicht mehr zwingend möglich sein wird, nachzuweisen, mit welchem Verfahren eine gentechnisch veränderte Saat beziehungsweise Pflanze hergestellt wurde. Lediglich das Saatgut soll als NGT-Produkt gekennzeichnet werden, um so eine Vermischung der Samen zu vermeiden.
Zwar könnten Landwirt*innen nur gentechnikfreies Saatgut verwenden, aber die Trennung in der weiteren Produktionskette von Lebensmitteln wäre nur mit einem sehr hohen Kostenaufwand möglich. Abgesehen davon wird die Übertragung von Pollen zwischen Feldern durch den Wind oder durch Bestäuber zu unvermeidbarer Vermischung führen. Zurzeit übernehmen Einzelhandelsunternehmen hohe Kosten zum Nachweis von Pestizidrückständen auf Bioprodukten. Ein ähnliches Szenario könnte sich mit gentechnikfreien Produkten ergeben, mit Mehrkosten für Unternehmen oder Verbraucher*innen. In der Frage von Maßnahmen für eine Koexistenz zwischen NGT-Pflanzen und gentechnikfreien Pflanzen wird in dem Gesetzentwurf lediglich auf die Verantwortung der Mitgliedstaaten verwiesen.
Patentierung von Pflanzen wird möglich
Im Fall, dass der Entwurf Realität wird, würde dies auch Einschränkungen für die konventionelle Landwirtschaft bedeuten. Ein von Saatgutzüchter*innen, Bäuer*innen und Umweltschutzorganisationen unterzeichneter Brief an Europas Agrarminister*innen warnt vor einer »Flut patentierten Saatguts auf dem EU-Markt«. Derzeit sind Pflanzensorten und Verfahren der konventionellen Züchtung nicht patentierbar, um zu gewährleisten, dass Saatgut sich frei kreuzen und vermehren lässt. Doch gemäß der bestehenden europäischen Gesetzgebung sind Erfindungen, die sich auf biologisches Material beziehen, grundsätzlich patentierbar. Demnach sind Produkte der neuen gentechnischen Verfahren auch als intellektuelles Eigentum zu bewerten.
Die Datenbank Espacenet des Europäischen Patentamts listet rund 700 Patentanmeldungen allein für »Crispr-Cas9 und Pflanzen«. Die Patentanmeldungen beziehen sich sowohl auf die genetische Information, zum Beispiel auf eine bestimmte Gensequenz, als auch auf das für deren Herstellung angewendete technologische Verfahren, beispielsweise Crispr-Cas9. Da keine Rückverfolgbarkeit der Herstellungsmethode gewährleistet wird, droht, dass alle Pflanzenarten, die eine patentierte DNA-Sequenz aufweisen, unter den Geltungsbereich des entsprechenden Patents fallen, also auch Pflanzen, die aus der konventionellen Züchtung stammen. Landwirt*innen und Pflanzenzüchter*innen müssten bei der Vermehrung ihres Saatguts Patentverletzungen befürchten.
Weniger diverses Saatgut
Das möchte auch Landwirtschaftsminister Cem Özedmir (Grüne) nicht: »Das Vorhaben darf nicht zur Einführung von Biopatenten durch die Hintertür führen. Das ginge zulasten unserer mittelständischen Zuchtunternehmen.« Denn als Folge müssten Landwirt*innen und Züchter*innen Lizenzvereinbarungen zugunsten großer Saatgutproduzenten abschließen, die mehr Kontrolle über den Saatgutmarkt erlangen würden. Bisher beherrschen vier Unternehmen 60 Prozent des kommerziellen Saatgutmarkts: Bayer-Monsanto, Corteva, Chem-China-Syngenta und Limagrain. Allerdings werden über drei Viertel des weltweit gewonnenen Saatguts nach wie vor durch den Nachbau und Tauschgeschäfte zwischen Bäuer*innen erworben. Wenn das europäische Gentechnikrecht aufgeweicht wird, droht eine weitere Konzentrierung des Saatgutmarkts auf wenige Akteure. Die Diversität des Saatguts würde sinken und neue Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Landwirt*innen und Saatgutproduzent*innen würden entstehen – keine gute Aussicht für die Landwirtschaft.
In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob der Entwurf eine Mehrheit im Ministerrat findet. Nicht nur Cem Özdemir, auch Minister*innen aus Österreich, Zypern, Ungarn, Luxemburg, der Slowakei, Belgien und Slowenien haben sich skeptisch gezeigt. Abgesehen davon benötigt das Konzept die Zustimmung des EU-Parlaments. Dort lehnen Grüne und Sozialdemokrat*innen die Aufweichung des Gentechnikrechts ab, während Konservative sich dafür aussprechen. Frans Timmermann, EU-Vizepräsident, hofft auf einen übergreifenden Deal. Gentechnik-Befürworter*innen sollen einem Gesetzentwurf zur Reduzierung von Pestiziden zustimmen und dafür Ja-Stimmen von Gentechnik-Skeptiker*innen für den NGT-Entwurf bekommen. Die alte Debatte um die Neue Gentechnik ist damit in Brüssel eröffnet und wird sich aller Ansicht nach nicht in den kommenden Wochen schlichten lassen.
Pascal Segura Kliesow ist Molekularbiologe und Referent für Landwirtschaft und Lebensmittel beim Gen-ethischen Netzwerk.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.