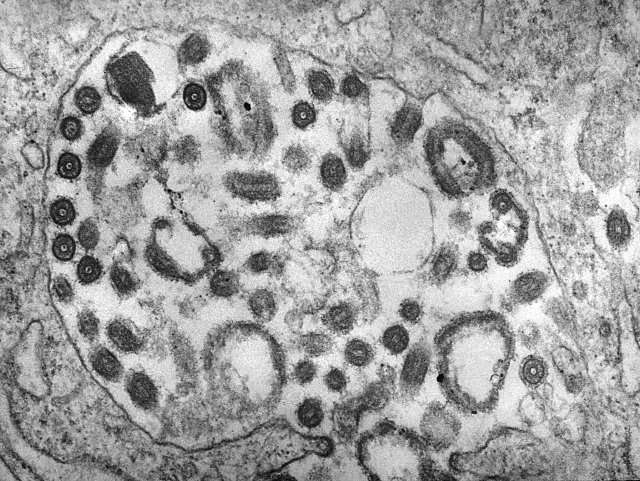- Wirtschaft und Umwelt
- Transplantationen
Ein Organspenderegister soll es richten
Die Aufklärung über Organspende schwächelt in Deutschland weiter
Deutschland hat ein Problem mit Organspenden: Es gibt zu wenige, in allen wichtigen Kategorien. Fast 8400 Menschen warten auf ein neues Organ, die meisten von ihnen, etwa 6500, auf eine Niere. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DCSO), die jede Organentnahme in Deutschland begleitet, verzeichnete aber im Jahr 2023 nur insgesamt 965 Spender. Seit Jahren wird nach Lösungen dafür gesucht, nicht nur die Spendenbereitschaft zu erhöhen, sondern auch zu erreichen, dass dies verbindlich dokumentiert wird.
An diesem Montag wird als nächster Versuch das neue Organspenderegister freigeschaltet. So sollen diejenigen genauer als bisher erfasst werden, die zu einer Organ- oder Gewebespende bereit sind. Bürgerinnen und Bürger können dabei über das Portal www.organspende-register.de ihre Haltung zum Thema dokumentieren. Simpel ist das nicht: Zunächst muss man sich mit der eID-Funktion des Personalausweises legitimieren. Hier werden sicher schon die ersten Interessenten aussteigen. Sie könnten es ab Juli erneut versuchen und dann ihre Gesundheits-ID der gesetzlichen Krankenkassen zu Authentifizierung nutzen. Auf diesem Weg wären aber privat Versicherte nicht zu erreichen.
Verzögerungen bei der Vorbereitung dieser Datenerfassung gab es jedoch schon länger. Der Beschluss zur Einführung des Registers von 2020 sollte eigentlich schon im März 2022 umgesetzt sein. Im Sommer 2022 nannt das Gesundheitsministerium IT-Sicherheitsprobleme und die Komplexität der Aufgabe als Ursachen für die Verspätung.
Bislang ist in Deutschland die »erweiterte Zustimmungslösung« gültig, und sie bleibt es auch mit dem Register. Für die Organentnahme nach dem Hirntod eines Menschen ist demnach die aktive Zustimmung des Betroffenen zu Lebzeiten, eines engen Angehörigen oder eines Bevollmächtigten erforderlich.
Aus Sicht von Medizinern verschiedener Fachrichtungen trägt das neue Register aber nicht dazu bei, dass sich mehr Menschen für eine Organspende entscheiden. Diese könnten nur mit verstärkter Informations- und Aufklärungsarbeit erreicht werden. In dem Gesetz, das auch für die Errichtung des Registers nötig war, ist das zwar einer der Kernpunkte – erledigen sollen es die Einwohnermeldeämter sowie die Hausärzte. Beides erscheint jedoch kaum praktikabel: Die Ämter haben so schon genug zu tun, Antragsteller sind froh, wenn sie einen der raren Termine erwischt haben und ein neues Dokument nach Hause tragen können. Die Hausärzte wiederum sind mit Aufgaben überlastet und haben ohnehin so wenig Zeit für die einzelnen Patienten, dass eine Diskussion zur Organspende in den Konsultationen eher nicht die Regel sein dürfte.
Auch in Bezug auf die Erfahrungen mit Registern in anderen europäischen Ländern (zum Beispiel in den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien oder der Schweiz) erklärte etwa Thomas Schmitz-Rixen von der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie: »Wir brauchen dafür flächendeckende und mehrsprachige Aufklärungskampagnen.« Die Organisation präferiert jedoch eine Kombination von Aufklärung und Widerspruchslösung, weil die Zustimmungslösung erfolglos geblieben sei. Bei einer Widerspruchslösung gelten zunächst alle Menschen automatisch als organspendebereit – es sei denn, sie widersprechen. Nur mit einer solchen Regelung ergebe ein Register Sinn, erklärt Dirk Stippel, Schwerpunktleiter Transplantation am Universitätsklinikum Köln: »Mit einer Zustimmungslösung ist so ein Register eher ein bürokratisches Hindernis.«
Weitere Verzögerungen bei der Nutzung des Registers scheinen schon sicher: So sind zum Start noch nicht alle Entnahmekliniken angebunden, und es wird empfohlen, den Organspendeausweis erst einmal weiter bei sich zu tragen.
Einer der Vorteile des Registers könnte sein, dass Angehörige bei Nichtauffinden eines Organspendeausweises auf diesem Weg Sicherheit über den Wunsch des oder der Verstorbenen gewinnen können. »In der Praxis ist die fehlende Kenntnis über die Entscheidung zur Bereitschaft zur Organspende eine Belastung für die Angehörigen«, weiß Felix Braun, Transplantationsbeauftragter am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.
Eine etwas laue Hoffnung in Bezug auf das neue Register besteht darin, dass der Start Anlass für viele Menschen sein könnte, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Diese Erwartung könnte trügerisch sein: Vermuten lässt das schon der bekannte Unterschied zwischen dem Anteil derjenigen, die prinzipiell zu einer Spende bereit sind, und dem deutlich niedrigeren Anteil derer, die das auch auf einem Spenderausweis dokumentiert haben und diesen auch bei sich tragen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.