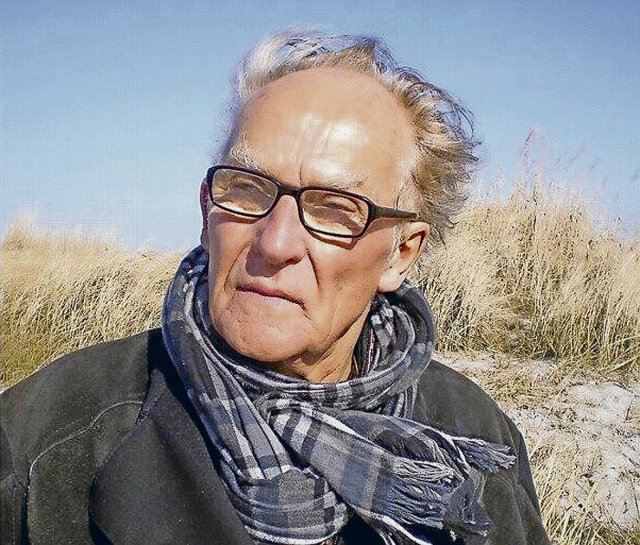- Kultur
- Ukraine
Eine Sprache verhüllen
Tschitschibabin und Bulgakow vergessen: In der Ukraine wird weiter gegen das Russische (und was man dafür hält) gekämpft

Entschuldigen Sie vielmals» begrüßt mich Vera Bulgakowa, Leiterin des Boris-Tschitschibabin-Museums in der ukrainischen Metropole Charkiw. «Ich habe es leider nicht mehr geschafft, vor Ihrem Besuch den Staub zu wischen.» Man sieht dem Museum an, dass es schon lange keine Besucher mehr gesehen hat. Nein, mit dem berühmten Schriftsteller Michail Bulgakow sei sie nicht verwandt, schiebt sie nach. Stolz ist sie trotzdem auf diesen Namen.
Ruhig ist es geworden im Museum im zweiten Stock des «Kommunalen Zentrums für Kulturinitiativen» in der Skypnyka-Straße im Stadtzentrum. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 dürfen in dem Museum, das einmal ein kulturelles Zentrum von Charkiw war, keine Veranstaltungen mehr stattfinden, angeblich aus Sicherheitsgründen. Verwunderlich nur, dass andere Kulturzentren in der gleichen Stadt sehr wohl weiterhin zu Konzerten, Ausstellungen und Lesungen einladen dürfen.
Boris Tschitschibabin (1923–1994) sei der größte aller Charkiwer Dichter, konnte man beispielsweise in der «Neuen Zürcher Zeitung» lesen, zweifellos ist er einer der großen Dichter der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Doch der Schriftsteller, der Zeit seines Lebens in Charkiw gelebt hat, wird heute in den Hintergrund gedrängt. Weil er auf Russisch geschrieben hat, wollen die ukrainischen Behörden, die weiterhin sein Museum finanzieren und eine nach ihm benannte Straße in Charkiw dulden, von ihm nichts mehr wissen. Dabei hatte der Schriftsteller, der mit bekannten Dissidenten und Schriftstellern wie Jewgeni Jewtuschenko und Bulat Okudschawa befreundet war, schon in der Sowjetunion Schwierigkeiten mit den Behörden. Unter Stalin war er fünf Jahre im Lager, viele seiner Werke fielen der Zensur zum Opfer.
Wer über den Haupteingang des «Kommunalen Zentrums für Kulturinitiativen» zum Tschitschibabin-Museum im zweiten Stock will, sieht eine Wand von Einschlägen übersät, Spuren der russischen Luftangriffe. Aus den teilweise mit Brettern verschlagenen Fenstern ragen weiße Sandsäcke. Gegenüber auf der anderen Straßenseite hatte vor dem Krieg die deutsche Honorarkonsulin residiert. Eine Tafel wies darauf hin, dass Boris Tschitschibabin in diesem Gebäude gearbeitet hat. Es gibt sie noch, aber verhüllt von einem schwarzen Tuch, weil sie in russischer Sprache gehalten ist. Verboten sind russischsprachige Hinweisschilder in der Ukraine nicht. Doch wer ein derartiges Schild hängen hat, ist laut ukrainischem Sprachengesetz verpflichtet, ein weiteres Schild in der gleichen Größe und Qualität daneben zu montieren. Nur: das Tschitschibabin-Museum hat hierfür nicht das notwendige Geld.
Seit den russischen Luftangriffen auf Charkiw wird Russisch als die Sprache des Aggressors wahrgenommen. Anfang April erklärte das Ukrainische Institut für Nationale Erinnerung, das der Regierung untersteht und maßgeblich die staatliche Erinnerungspolitik prägt, den Schriftsteller Michail Bulgakow (1891–1940) zum «Ukrainehasser». Bulgakow, der unter Stalin kaum noch veröffentlichen konnte, habe nach Ansicht des Instituts ungeachtet seiner Jahre in Kiew, die Ukrainer und ihre Kultur gehasst. Der Schriftsteller, dessen Hauptwerk «Der Meister und Margarita» eine Satire auf die sowjetische Bürokratie darstellt und das erst 1966 erscheinen durfte, stehe den Ideologen des Putinismus sehr nahe, meint man. Bulgakow habe Positionen des russischen Imperialismus vertreten und der ukrainischen Nation ihr Recht auf einen eigenen, von Russland getrennten Weg absprechen wollen.
In seinen Werken komme kein ukrainischer Protagonist gut weg. Vielmehr würden die Ukrainer in seinen Werken parodiert, die ukrainische Sprache verspottet, kurz: Bulgakow sei ein Leugner der ukrainischen Nation. Somit sei in Übereinstimmung mit dem Gesetz, das die Verwendung von Symbolen einer russischen imperialen Politik verbietet, eine weitere Verwendung des Namens von Michail Bulgakow in der Bezeichnung von geografischen Objekten und juristischen Personen, zu verbieten. Auch Denkmäler und Symbole im öffentlichen Raum zu seinen Ehren seien als russische Propaganda einzustufen.
«Das ist doch absurd», sagt mir Liliya Karas-Tschitschibabina, die Witwe des Schriftstellers Boris Tschitschibabin. «Bulgakow war immer und wird immer ein wichtiger Teil der von ihm so geliebten Stadt Kiew sein.» Irgendwann, so hofft sie, werde die Entscheidung wieder zurückgenommen werden.
«Alles, was sie in ihrem Gutachten schreiben, ist frei erfunden, einfach nur Unsinn», kritisiert auch Anatoli Kontschakowski, der Gründer des Kiewer Bulgakow-Museums, in der Onlinezeitung «strana.ua», die sowohl von ukrainischer wie russischer Seite inkriminiert wird, das Institut. Es sei nicht wahr, dass Bulgakow ein ukraninophober «Imperialist» gewesen sei, in seinen Briefen und Tagebüchern finde sich dafür keinerlei Beleg.
Vor einem Jahr hat der Stadtrat von Kiew das öffentliche Abspielen von russischer Musik verboten. Dem ukrainischen Parlament liegt ein Gesetzesentwurf vor, der über 330 Ortsnamen, die in irgendeiner Weise einen Bezug zu Russland haben, ändern will. Sollte dieses Gesetz verabschiedet werden, wird es in der Ukraine keine Orts- und Straßennamen wie Nowomoskowsk, Puschkino, Maxim Gorki oder Perwomajsk mehr geben.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.