- Wissen
- Trauma und Sucht
»Abhängigkeit ist nicht nur verbunden mit der Substanz«
Der Psychiater und Psychotherapeut Ingo Schäfer im Gespräch über den Zusammenhang von Sucht und traumatischen Erfahrungen
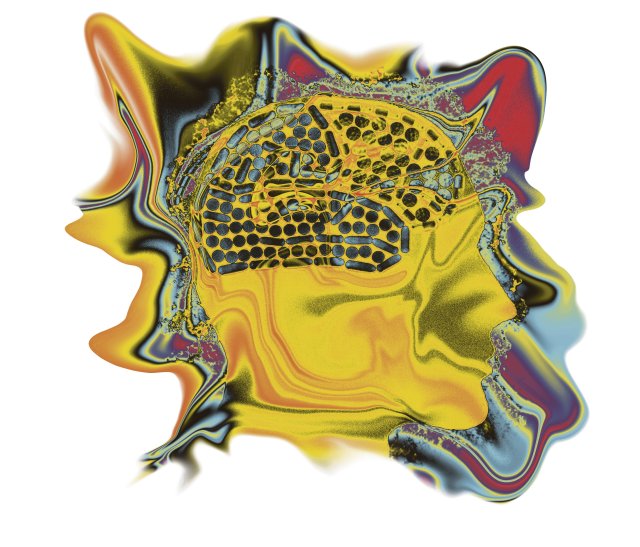
Kürzlich wurde berichtet, dass die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen sei. Spiegelt das eine gesellschaftliche Entwicklung wider?
Zunächst macht das deutlich, dass wir nach wie vor nachbessern müssen in Bezug auf niedrigschwellige, schadensreduzierende Angebote für Konsument*innen. Die Hauptursache für den Drogentod ist ja nach wie vor Heroin, wie die Zahlen zeigen. Es gibt auch vielerorts hilfreiche Ansätze wie Konsumräume oder andere Möglichkeiten, Konsument*innen einen möglichst schadensarmen Konsum möglich zu machen. Die Zahlen deuten aber leider darauf hin, dass wir hier noch nicht am Ziel sind.
Nun gibt es ja sehr verschiedene Arten von Drogenkonsum. Und nicht alle Leute scheinen gleich auf Drogen anzusprechen. Kann man sagen, wann und wen eine Droge süchtig macht?
Es ist ein komplexes Phänomen. Man hat lange geforscht, inwieweit zum Beispiel die Selbstmedikation mit bestimmten Substanzen Personen, die unter psychischen Belastungen leiden oder an psychischen Symptomen, geeignet erscheint, um ihre jeweils spezifische Problematik erträglicher zu machen. Andererseits hat sich dann in Studien gezeigt, dass es auch um die Verfügbarkeit geht. Das heißt, es gibt offensichtlich auch externe Faktoren, die dazu beitragen, auf welche Schiene Leute später mit ihrem Konsum kommen. Es ist eine Mischung aus personenbezogenen Faktoren, aber auch Umgebungsfaktoren.

Professor Dr. med. Ingo Schäfer ist seit 2017 Direktor des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg. Schwerpunkte seiner Arbeit sind psychische Belastungen bei Personen mit Substanzstörungen und die Weiterentwicklung von Versorgungsangeboten im Bereich der Suchthilfe.
Generalisiert betrachtet, was machen die Drogen im Gehirn?
Alle Drogen, einschließlich Nikotin und Alkohol, stimulieren das sogenannte endogene Belohnungssystem im Gehirn. Das ist eine entwicklungsgeschichtlich sehr alte Hirnstruktur, die eigentlich der Sicherung des Überlebens der Art dient. Das heißt, das System belohnt die Suche nach Reizen, wie zum Beispiel Nahrung oder auch Sexualpartner*innen. Da spielen verschiedene Botenstoffe eine Rolle, unter anderem das Dopamin. Psychotrope Substanzen, die über das Belohnungssystem wirken, haben die Fähigkeit, die Dopaminausschüttung dort wesentlich effizienter zu erhöhen als die natürlichen Reize, was dann eine ganz wichtige Rolle spielt bei der Entwicklung von manifesten Abhängigkeitserkrankungen.
Baut der Konsum auch langfristig das Gehirn um? Wer zum Beispiel mit dem Rauchen aufhört, verspürt nach kurzer Zeit keine körperliche Abhängigkeit mehr, aber trotzdem diesen Drang zu rauchen.
Es ist natürlich so, dass in frühen Phasen der Abstinenz auch Craving, also Suchtverlangen, typisch ist. Dieser Effekt, diese starke Kopplung von Konsum und Belohnungserleben im Gehirn, die bleibt über einen gewissen Zeitraum bestehen und löst das Suchtverlangen aus, schwächt sich aber ab. Aber das sogenannte Suchtgedächtnis bleibt auch langfristig bestehen. Das heißt, wenn Betroffene irgendwann wieder konsumieren, vielleicht nach längerer Abstinenz, dann zeigt sich typischerweise ein sehr schnelles, erneutes Auftreten der bisherigen Konsummuster. Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel für alkoholkranke Menschen oder Raucher*innen so wichtig ist, später auch nicht nur ein bisschen zu konsumieren.
Viele Leute konsumieren auch nur gelegentlich beim Feiern, insbesondere sogenannte Partydrogen. Riskieren sie weniger eine Abhängigkeit?
Das Phänomen der Abhängigkeit ist eben nicht nur verbunden mit der Substanz, sondern auch mit der Person, dem Setting, dem Umfeld, der Situation und dann auch noch den spezifischen Substanzwirkungen. Partykonsument*innen, die keine Abhängigkeit entwickeln, sind oft eher integrierte Personen, die vielleicht einer geregelten Arbeit nachgehen oder studieren und einen relativ normalen Alltagskontext haben. Sie konsumieren dann in einem ganz bestimmten Kontext vor dem Hintergrund einer eigentlich guten psychischen Verfassung und haben keine Probleme, es auch bei diesem Konsumverhalten zu belassen. Es ist etwas ganz anderes, wenn eine Person, die keine so guten Voraussetzungen hat, sozial schlechter gestellt ist, schlechter integriert ist, die mit Depressionen zu kämpfen hat, in einem ganz anderen Kontext an dieselbe Substanz gerät und eine Abhängigkeit entwickelt. Wir haben zum Beispiel in den vergangenen Jahren eine Untersuchung gemacht zu Kokainkonsumierenden und Konsummustern, in der sich sehr deutlich zeigt, dass es eine große Gruppe gibt von integriert Konsumierenden, die mal bei Partys konsumieren. Und dann gibt es aber auch andere Gruppen, in denen dann typischerweise auch psychische Komorbiditäten eine Rolle spielen. Diese Gruppen zeigen ganz andere Konsummuster.
Welche Rolle spielen insbesondere traumatische Erfahrungen im Leben beim Konsum und der Entwicklung von Sucht?
Traumatische Erfahrungen sind bei einer großen Gruppe von Menschen mit Suchtproblemen ein ganz wesentlicher Faktor, was den Einstieg in den Konsum angeht, aber auch die Aufrechterhaltung. Langzeituntersuchungen haben gezeigt, dass Traumatisierungen in der Kindheit wie sexualisierte, körperliche, emotionale Gewalt oder Vernachlässigung zu den robustesten Risikofaktoren gehören für einen späteren problematischen Substanzkonsum. Das sehen wir auch in der Arbeit mit Suchtkranken. Das betrifft zum Beispiel bei Menschen mit Alkoholabhängigkeit mindestens 50 Prozent und bei Menschen, die sogenannte harte Drogen konsumieren, einen noch wesentlich höheren Anteil, der von solchen Belastungen aus der Kindheit berichtet. Und auch hier zeigen uns die Studien, dass es Zusammenhänge gibt zwischen dem Erlebten und seinen Folgen, wie zum Beispiel posttraumatischen Störungen, Problemen, mit Gefühlen umzugehen, bestimmten Bewältigungsstrategien, die erworben wurden oder eben nicht erworben wurden, und dem späteren Konsum und auch dem Erfolg von Suchttherapie. Das ist einer der Gründe, warum wir das auch systematisch in Suchttherapien berücksichtigen müssten. Das geschieht inzwischen zum Teil, aber noch nicht flächendeckend.
Das heißt also, wenn eine Person, die entsprechende traumatische Erfahrungen hat, gewillt ist, eine Suchttherapie zu beginnen, müsste sie parallel oder sogar zuerst diese Traumata bearbeiten?
Diese Sichtweise, dass man eine der beiden Problematiken zunächst in den Vordergrund stellt, greift bei vielen Menschen leider zu kurz. Es geht definitiv darum, beides zu integrieren oder parallel zu behandeln. Da steht am Anfang erst einmal das Anerkennen dessen, dass diese gravierenden Erlebnisse in der Biografie überhaupt eine Rolle spielen und wie sie sich heute noch im Alltag zeigen. Und dann die Integration von Interventionen aus der Traumatherapie in die Suchtbehandlung.
Sie beschäftigen sich in einem aktuellen Projekt mit der Prävention und Behandlung von Suchtproblemen geflüchteter Menschen. Welche Erfahrungen haben Sie bei dieser Arbeit gemacht?
Zum einen ist es so, dass Menschen mit Fluchthintergrund zu einem ganz hohen Anteil schwere Belastungen erleben mussten. Der Grund, warum sie in Europa Schutz suchen, ist ja oft, dass sie in den Herkunftsländern Krieg und Verfolgung ausgesetzt waren. Zum anderen ist die Flucht mit Belastungen verbunden und nicht zuletzt gibt es sogenannte Postmigrationsstressoren: Statusverlust, Ressourcenverlust, Unterbringung, die sehr stressvoll sein kann, oder auch Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen. All diese Stressoren begünstigen Konsum. Wir sehen das nicht in allen Gruppen von geflüchteten Menschen. So gibt es auch Schutzfaktoren, zum Beispiel religiöse Überzeugungen. Aber für die Konsumierenden müssen wir passgenaue Hilfsangebote machen. Und genau da liegt das Problem. Menschen mit Fluchthintergrund finden in vielerlei Hinsicht viel schlechter ins Hilfesystem als Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind. Und das betrifft eben auch das Suchthilfesystem. Da spielt zum Beispiel die mangelnde Versorgung mit Sprachmittlung eine Rolle, oder dass Helfende in den Einrichtungen unter Umständen Nachholbedarf haben in Bezug auf eine kultursensible Arbeit. Betroffenen kann die Kontaktaufnahme mit Institutionen auch eher bedrohlich erscheinen. Es kommen also viele Faktoren zusammen, auf die wir uns einstellen müssen.
Vielleicht wäre ein erster Schritt vor den Suchthilfeangeboten, die Geflüchteten auch menschenwürdig unterzubringen.
Absolut. Es zeigt sich zum Beispiel auch, dass eine gelingende Integration gerade bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die ganz hohe Raten von Substanzkonsum zeigen, in vielen Fällen dazu führt, dass der Konsum überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also eine bessere Unterbringung, bessere Zugänge zu unserer Gesellschaft, eine bessere Integration wären hier die beste Suchtprävention.
Drogen können durchaus auch im positiven Sinn eingesetzt werden. So gibt es in der Psychotherapie wieder mehr Ansätze, auch mit psychoaktiven Substanzen zu arbeiten. Wie sind sie zu bewerten?
Das ist eine sehr interessante Entwicklung und es ist erfreulich, dass es da eine große Offenheit gibt. Es gibt viel Forschung zu unterschiedlichen Substanzen als unterstützende Hilfsmittel im Rahmen einer Psychotherapie. Da sind Halluzinogene zu nennen, aber auch zum Beispiel MDMA, das gerade bei der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung sehr vielversprechende Ergebnisse zeigt. Ketamin wird inzwischen bei chronischer Depression erfolgreich eingesetzt. Da öffnet sich ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten, zu denen sicher auch noch mehr Forschung nötig ist, in denen aber ganz eindeutig Chancen liegen.
Was müsste in Hinblick auf die Zulassung dieser Substanzen für die Therapie geschehen?
In Deutschland sind sie noch nicht zugelassen, mit Ausnahme von Ketamin. Da sind andere Länder schon weiter.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







