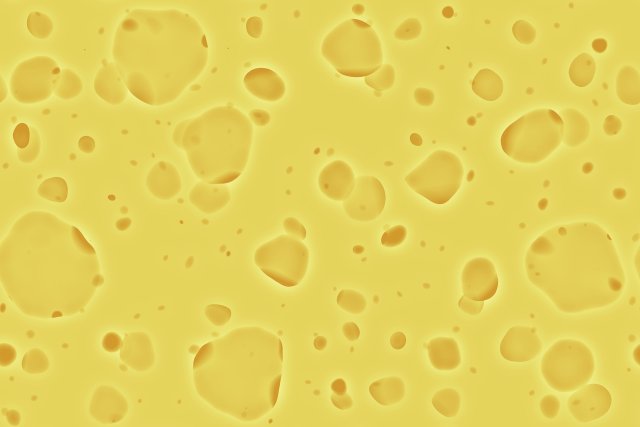- Kultur
- Friedliche Revolution
Montagsdemonstrationen in Leipzig: Die Selbstermächtigung
Katrin Hattenhauer über die erste Leipziger Montagsdemonstration1989, den 9. November und Zivilcourage heute

Sie gehörten zu den Initiatoren der Leipziger Montagsdemonstrationen und trugen bei der ersten am 4. September 1989 mit Gesine Oltmanns ein Transparent mit der Aufschrift »Für ein offenes Land mit freien Menschen«. Damals folgten Ihnen bereits mehrere hundert Menschen. Haben Sie sich vorstellen können, dass es am 9. Oktober 70 000, zwei Wochen später schon 300 000 und am 6. November gar eine halbe Million sein würden?
Nein, aber wir haben gehofft, die Menschen in Leipzig und im ganzen Land im wahrsten Sinne des Wortes zu bewegen, auf die Straße zu gehen und für Veränderungen zu demonstrieren. Am 4. September 1989 fand das erste Friedensgebet in der Nikolaikirche nach der Sommerpause statt. Zugleich war es ein Messemontag und Westjournalisten waren in Leipzig. »Für ein offenes Land mit freien Menschen« war ein klares, berührendes Bekenntnis, wofür wir standen und warum wir das Land nicht verlassen wollten.
Zu diesem Zeitpunkt haben bereits Zehntausende über die ungarisch-österreichische Grenze die DDR Richtung Westen verlassen, andere hatten Zuflucht in den bundesdeutschen Botschaften in Prag und Budapest gesucht ...
Wir haben fünf verschiedene Transparente gemalt und mit »Reisefreiheit statt Massenflucht« direkt auf diese Vorgänge reagiert. Ich gehörte in Leipzig dem Arbeitskreis Gerechtigkeit an, einer konspirativ arbeitenden Oppositionsgruppe, eine geschlossene Gesellschaft von Menschen, die sich gut kannten und längere Zeit in der Opposition zusammengearbeitet hatten. Wir mussten einander zu hundert Prozent vertrauen können, vor Staatssicherheitsspitzel oder Verräter schützen. Nach dem Sommer der großen Fluchtwelle über Ungarn war ich der Meinung, dass wir Stellung beziehen mussten, warum wir noch da waren, wofür wir standen. Wenn es nicht bei Gebeten in der Kirche bleiben sollte, dann mussten wir den Protest heraustragen auf die Straße. Unsere Gruppe war in dieser Frage gespalten, denn das Risiko, dass wir alle ins Gefängnis gehen würden, ohne etwas angestoßen zu haben, war groß. Doch einzelne Freunde aus dem Arbeitskreis Gerechtigkeit waren meiner Ansicht. Ich überlegte, wie wir an diesem 4. September ein unvergessliches, starkes, zu Herzen gehendes Bild entstehen lassen konnten.
-
/ Sarah Yolanda KossMietminderung auf KnopfdruckStudie: Mietendeckel könnte Angebotsmieten in Städten mit Wohnungsnotlage um 46 Prozent verringern
-
/ Hendrik LaschSören Pellmann: Konkurrenz unter neuen VorzeichenIn Leipzig kämpft Sören Pellmann um ein Direktmandat für Die Linke, was ausgerechnet ein Ex-Genosse verhindern könnte
-
/ Wolfgang HübnerSilberlockeneinsatzkommandoSie haben einen Plan: Mit der Mission Silberlocke landet ein Linke-Seniorentrio einen Erfolg in den Medien und bei jungen Wählern
Wie sind Sie zur Opposition gestoßen?

Katrin Hattenhauer, am 10. November 1968 im thüringischen Nordhausen geboren, durfte kein Abitur ablegen und war nach ihrer Schulzeit zunächst am Theater ihrer Geburtsstadt als Puppenspielerin tätig. 1988 begann sie ein Studium am Theologischen Seminar in Leipzig, das sie nach einem halben ...
Mit 15 Jahren begann ich in einem Umweltarbeitskreis in meiner Geburtsstadt Nordhausen mitzuarbeiten. Ich hatte damals viele Fragen und das sichere Gefühl dafür, dass sie zu stellen der Beginn von Schwierigkeiten war. Ich weiß noch, wie meine Großmutter zu meiner Mutter sagte: »Gewöhne dem Kind das öffentliche Fragen ab, sonst kommen wir alle noch in Teufels Küche.« Ich habe all die Widersprüche gesehen: »Die Frau im Sozialismus ist glücklich, hat Kinder und kann trotzdem arbeiten gehen.« Mein Vater ist kurz vor meiner Geburt tödlich verunglückt. Meine Mutter zog uns vier Kinder allein groß, arbeitete im Drei-Schicht-System und selbst mit Kindergeld reichte es bei uns vorne und hinten nicht. Meine Mutter war keine glückliche Frau im Sozialismus. Sie war oft überarbeitet und müde, weil sie in der Nacht für uns Sachen nähte oder strickte, um Geld zu sparen. Sie und ihre Freundinnen gingen auch nicht wählen, und sie waren nicht die einzigen Nichtwähler. Da war es für mich natürlich ein Rätsel, wie 99,9 Prozent Zustimmung für die Kandidaten der SED und der Blockparteien zusammenkommen konnten. Und auch, warum – wenn wir doch im besseren und gerechteren Deutschland lebten – eine Mauer errichtet werden musste, um die Menschen vom Weglaufen abzuhalten.
Sie sind nicht am 4. September, sondern eine Woche später, bei der zweiten Montagsdemonstration, verhaftet worden. Was haben Sie von den Ereignissen vom 9. Oktober in Leipzig mitbekommen, als sich die Situation dramatisch zugespitzt hatte, eine Eskalation der Gewalt drohte?
Ich habe nicht viel von »draußen« mitbekommen. Ich war allein in meiner Zelle im Stasi-Untersuchungsgefängnis in der Beethovenstraße, hatte Isolationshaft, weil ich mich weigerte auszusagen. Das Gebäude befand sich nur einen Steinwurf vom Ring entfernt, wo – wie ich später erfuhr – geschätzt 70 000 Menschen an diesem Montag demonstriert haben. Ich habe allerdings die Nervosität der Wärter gespürt, die sonst immer regelmäßig im Abstand von wenigen Minuten vorbeikamen und durch das Guckloch in unsere Zellen schauten. An diesem Tag kontrollierten sie uns nur selten. Und dann war da so ein undefinierbares Rumoren zu hören und der Boden zitterte etwas, als wenn schweres Gerät vorbeifuhr. Deshalb hatte ich Sorge, dass draußen Panzer eingesetzt werden. Die Insassen nutzten aber eine Art Klopfalphabet, um sich auszutauschen und Nachrichten weiterzugeben. Doch was kann die kurze Nachricht »Blumen und Kerzen an der Nikolaikirche« alles bedeuten? Das konnte auch heißen: Es hat Tote gegeben. Als ich dann am 13. Oktober überraschend entlassen wurde, sah ich draußen überall glückliche, stolze Gesichter und tanzende Menschen.
Wie haben Sie den Mauerfall, den 9. November, erlebt?
In der Nacht des Mauerfalls bin ich auf den Straßen von Berlin 21 Jahre alt geworden, habe mit Fremden getanzt, gelacht, getrunken und auf die Freiheit und ein neues Leben angestoßen. Bei meiner Entlassung hatte ich zwar meinen Ausweis nicht zurückerhalten und stattdessen Auflagen bekommen, durfte Leipzig nicht verlassen. Ich war ja nicht freigesprochen worden und sollte mich für weitere Vernehmungen zur Verfügung halten. Ich wollte aber unbedingt mit Freunden in Berlin in meinen Geburtstag am 10. November hineinfeiern. Und das haben wir auch in einer Kneipe nahe der Bornholmer Brücke getan. Gegen Abend kamen die ersten Gerüchte auf. Die Kneipe leerte sich und meine Freunde wollten aufbrechen, als der Wirt sagte: »Leute, ihr könnt hierbleiben, aber ich gehe mal gucken.« Ich war nicht scharf darauf, in eine Kontrolle zu geraten. Aber die Neugierde war einfach zu groß, also machten auch ich mich mit meinen Freunden auf den Weg Richtung Bornholmer Brücke. Dort war bereits ein gewaltiger Menschenauflauf und die Grenzpolizisten winkten die Menschen durch. Wir waren dann am Kurfürstendamm. Es war eine unglaubliche Stimmung. In dieser Nacht waren sich die Ost- und Westdeutschen so nah und glücklich wiedervereint wie möglicherweise seitdem nicht wieder. Und ich bin froh, das erlebt zu haben. Den Fall der Mauer habe ich als persönliches Geburtstagsgeschenk empfunden.
Nach dem 9. November wollte die Mehrheit der DDR-Bürger nicht mehr ein reformiertes Land, sondern die Vereinigung. Empfanden Sie sich da der Früchte ihres jahrelangen Kampfes beraubt?
Die Menschen haben sich bei uns bedankt, dass wir eine Tür geöffnet haben. Aber wir waren nicht mit der Forderung nach Wiedervereinigung angetreten. Bei den Volkskammerwahlen im März 1990 hat sich dann eine überwältigende Mehrheit für die Politik von Helmut Kohl ausgesprochen. Das ist kein Vorwurf, nur eine Erinnerung daran, dass die Menschen im Osten gefragt wurden und gewählt haben. Es ist richtig, wie es gekommen ist, dass wir wieder ein Land wurden und das, was für meine Großeltern normal war, auch für meinen Sohn wieder normal ist.
Nach dem 9. November war die SED-DDR zu Ende und das wiedervereinigte Deutschland war noch nicht da. Es war eine Art Zeitkapsel, die ich in glücklicher Erinnerung habe - mit vielen Träumen und Utopien, und mit noch mehr Engagement von vielen Menschen, mit den Häusern der Demokratie in vielen Städten und Runden Tischen des Austausches und des Planens einer neuen Gesellschaft.
Das klingt etwas wehmütig.
Es war uns als Opposition in der DDR nicht das gleiche Glück vergönnt wie den Tschechen mit Václav Havel oder den Polen mit derSolidarność, ein neues Land selbstbestimmt aufzubauen. Richard von Weizsäcker, damals Bundespräsident, kam 1990 zu uns nach Leipzig, um uns zu danken. Ohne dass es explizit gesagt wurde verstanden wir: Danke, jetzt übernehmen wir.
Was ist für sie wichtiger: das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, das Sie 2015 erhielten, oder das Lob von Freya von Moltke für Ihren Einsatz für Freiheit 1989?
Ich will das nicht gegeneinander aufwiegen. Beides hat seine Bedeutung. Die Begegnungen mit Freya von Moltke und auch ihrem Neffen Matteo Deichmann sind ein besonderes Geschenk für mich. Sie ist ja in die USA gegangen, weil sie – wie auch andere Angehörige des Widerstandes – im Nachkriegsdeutschland zunächst oft als »Landesverräter« angesehen worden ist, die angeblich Mitschuld daran hatte, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Sie sagte mir einmal: »Es wird eine ganze Weile brauchen, bis die Menschen erkennen, was ihr für die Gemeinschaft und euer Land geleistet habt.«

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Im Trickfilm »Fritzi – Eine Wendewundergeschichte« wird das Plakat »Für ein offenes Land mit freien Menschen« von zwei Männern getragen.
Was der historischen Wahrheit widerspricht. Einem bärtigen Mann und einem Punker wären die Leipziger damals sicher nicht so unbeschwert gefolgt wie zwei jungen Frauen. Hinzu kommt, dass in »Fritzi« drei adrett gekleidete Mädchen unter dem Transparent stehen wie ein Schmuckelement, während die Männer die wirklich »tragende« Rolle spielen. Dabei hätte es ohne uns Frauen den 4. September 89 gar nicht gegeben! Es ist interessant, dass wir uns gegenseitig korrigieren, wenn wir nicht gendern, wir verfolgen zu Recht und dankbar weltweite Bewegungen wie #metoo oder Women Life Freedom im Iran. Aber mir wird gesagt, das sei doch nicht schlimm, dass unser ikonisches Transparent im Film nun von Männern getragen wird. Ich frage mich, was all den Kindern, Jungen wie Mädchen, die den Film sahen und noch sehen werden, für ein Rollenbild vermittelt und was für eine Chance da verpasst wird.
Und das geht weiter im Stadtbild von Leipzig. Am Seitenausgang der Nikolaikirche, von wo aus wir mit unserem Transparent am 4. September auf die Straße gingen, steht eine Stele, die an unsere Aktion erinnert. Sie ist schon fast zugewachsen. Wir haben damals Gesicht gezeigt für Freiheit und Demokratie, aber man hat ein Foto gewählt, auf dem unsere Gesichter nicht zu sehen sind. Und auch nach 35 Jahren stehen unsere Namen immer noch nicht auf der Stele. Es kommt schon darauf an, wie wir Geschichte erzählen.
Den Begriff »Friedliche Revolution« soll der ehemalige Regierende Bürgermeister von Westberlin, Walter Momper, geprägt haben?
Das ist ein Narrativ, das nicht exakt ist. In den 90ern hielt sich lange das Wort von der »Wende«, von Egon Krenz seinerzeit eingeführt. Es verkleinert, verniedlicht die Bewegung, die wir angestoßen haben und welche die Menschen ermutigte, auf die Straße zu gehen, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Denn das ist nicht vergleichbar mit einem Wendemanöver, das man mit einem Auto unternimmt, weil man sich verfahren hat. Wir haben uns als Revolutionäre empfunden. Herr Momper hatte offensichtlich ein gutes Gespür für diesen Unterschied und hat deshalb unsere Wortwahl aufgegriffen und öffentlich verwendet.
Was sagen Sie zum allgemeinen Verdikt »Der Osten ist braun«?
Wir würden auch nicht sagen, dass Baden-Württemberg grün ist – weil es einen grünen Ministerpräsidenten hat. Diese Aussage wird den vielen Menschen im Osten nicht gerecht, die sich zivilgesellschaftlich für die Demokratie engagieren, sie leben und verteidigen. Demokratie ist in der Natur der Sache ein Prozess und kein fertiger abgeschlossener Zustand. Demokratie bedeutet nicht Konsens, sondern Kompromiss. Demokratie bietet keine einfachen oder schnellen Lösungen, sie setzt voraus, dass jeder Einzelne bereit ist, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur seine Stimme alle paar Jahre im wahrsten Sinne des Wortes abzugeben. Die Populisten behaupten: »Wenn ihr uns wählt, bekommt ihr, was ihr wollt und das ganz einfach und schnell.« Das ist eine Lüge. Demokratie braucht Engagement und Zivilcourage. Und wir alle brauchen Zuversicht, Motivation und Hoffnung für unser Engagement. Geschichten über Mut, Güte und Klugheit sind da wichtig, ob es die Geschichte von David gegen Goliath oder von Jeanne d’ Arc ist.
Wir alle kennen die Geschichte von Malala, die 2019 von Taliban überfallen, aus dem Schulbus gezerrt und durch mehrere Kugeln lebensbedrohlich verletzt wurde, jüngste Nobelpreisträgerin, die sich weltweit für die Rechte von Mädchen und Frauen einsetzt. Sie ist von ihrem Vater bewusst nach der Dichterin Malalai von Maiwand benannt worden, der Jeanne d’ Arc der Afghanen. Als sie später einmal gefragt wurde, ob der Vater ihr mit dieser Namensgebung nicht eine schwere Bürde auferlegt habe, antwortete sie: »My father named me Malala, but he didn’t make me Malala.« Was für eine selbstbestimmte und gute Antwort! Er hat sie Malala genannt, aber nicht zu Malala gemacht. Das war ihre eigene Entscheidung. Diesen Mut und diese Selbstermächtigungen braucht es überall, um die Welt ein Stückchen besser, gerechter, humaner, freundlicher zu gestalten.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.