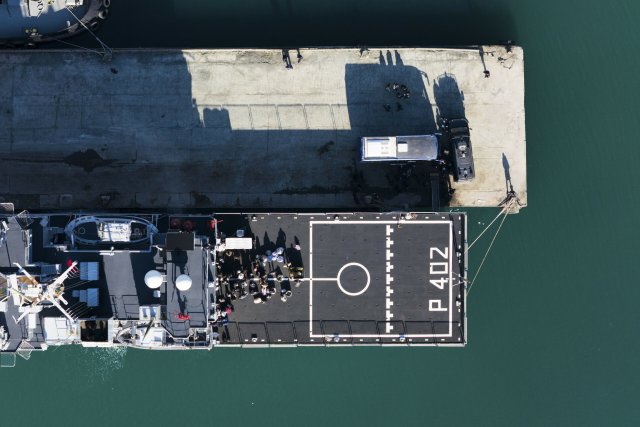- Politik
- Schwerpunkt: Sozialpolitik im Wahlkampf
Pferdeäpfel und Heckenschere
Unter dem Deckmantel der sozialen Gerechtigkeit wird oft Klassenpolitik von oben betrieben

In Zeiten knapper Kassen – wenn Sätze so anfangen, sollte man genau hinhören. Fast immer geht es dann darum, ob soziale Programme, Kulturförderung oder Projekte der Infrastruktur weiter bezahlt werden können. Dagegen heißt es bei Rüstungs- und Militärthemen: »Trotz knapper Kassen« müsse dies und jenes gewährleisten werden. Dem Ob steht ein »Jetzt erst recht« gegenüber; Fragen des Gemeinwohls werden so rhetorisch zur Verfügungsmasse für vermeintlich schlechte Zeiten erklärt.
In diesem Denken ist Sozialpolitik etwas, was man sich leisten kann – oder eben nicht. Von Gerechtigkeit reden alle Parteien, aber das Verständnis dieses Begriffs unterscheidet sich teils diametral. Die entscheidende Frage heißt: Gerechtigkeit für wen? Die Spannbreite reicht von Leistungsgerechtigkeit (CDU), Chancengerechtigkeit (SPD) und Generationengerechtigkeit (Grüne) bis zur Verteilungsgerechtigkeit (Linke), die sich nach dem Bedarf der Menschen richtet. Der Philosoph Adam Smith hoffte im 18. Jahrhundert, dass in einer gut regierten Gesellschaft der universelle Reichtum »sich bis zu den niedrigsten Bevölkerungsständen verbreitet«. Der Ökonom John Kenneth Galbraith postulierte im 20. Jahrhundert etwas, was als Pferdeapfel-Theorem bekannt wurde: »Wenn man den Pferden genug Hafer gibt, kommt am Ende auch etwas als Futter für die Spatzen heraus.« Das heißt: Geht es den sogenannten Leistungsträgern, den Reichen gut, fällt auch für die Armen etwas ab. Das Gegenstück fasste der Dialektiker Bertolt Brecht in knappe Worte: »Reicher Mann und armer Mann standen da und sah’n sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär’ ich nicht arm, wärst du nicht reich.«
Soziale Gerechtigkeit wurde schon immer nach Kassenlage gehegt oder gerupft. Es war mit Gerhard Schröder ein Sozialdemokrat, der gemeinsam mit dem Briten Tony Blair das Konzept der Neuen Mitte proklamierte, dessen konkreter Ausfluss in Deutschland die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze wurden – ein rabiates Sozialkürzungsprogramm. Den gleichen Geist atmete die ebenfalls von der SPD angeschobene Rentenreform mit der Erhöhung des Rentenalters auf 67 – in der Praxis eine enorme Rentenkürzung. Zuvor hatte schon eine CDU-Expertenkommission die Anhebung des Rentenalters empfohlen, der in jungen Jahren bereits Friedrich Merz und Ursula von der Leyen angehörten.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Nicht immer manifestiert sich Gefahr für die soziale Sicherheit in unmittelbaren Kürzungsmaßnahmen. Armut und soziale Schieflagen verschärfen sich auch, wenn Politik es unterlässt, das Nötige zu tun. Wenn viel zu wenige bezahlbare Sozialwohnungen gebaut werden, wenn der Mindestlohn nicht angemessen steigt, wenn Kranken- und Pflegeversicherung teurer werden, wenn das versprochene Klimageld nicht kommt, wenn die Kindergrundsicherung von den Grünen dilettantisch vorbereitet und von der FDP lustvoll bekämpft wird – dann leiden die vielen Menschen mit kleinen Einkommen darunter.
Zumal dann, wenn Regierungen nichts tun, um Reichtum umzuverteilen. Warum wurde die 1997 ausgesetzte Vermögensteuer nicht längst wieder eingeführt? Warum gibt es keine Reichensteuer? Warum gibt es noch immer die Trennung zwischen Pensions- und Rentensystem, zwischen privaten und gesetzlichen Krankenkassen? Warum werden in den gesetzlichen Krankenkassen die Beiträge bei Einkommen von etwas über 5000 Euro im Monat gedeckelt, wodurch Besserverdienende nicht angemessen einzahlen? Warum gibt es nicht schon längst eine umfassende Finanztransaktionssteuer? Vom früheren CDU-Politiker Heiner Geißler stammt der Satz: »Es gibt Geld wie Dreck auf der Welt, es haben nur die falschen Leute.«
Im gegenwärtigen Wahlkampf wird unverhüllt gedroht, die sozialpolitischen Zügel straff anzuziehen. Es geht etwa um unbezahlte Krankentage und Kürzungen beim Bürgergeld. Union, AfD und vor allem FDP wollen zumindest im Sozialbereich so wenig Staat wie möglich. Keineswegs zufällig himmelt ein Teil der FDP den argentinischen Marktfetischisten Javier Milei an. Auch wenn Parteichef Christian Lindner statt mit Mileis Kettensäge vorerst mit der Heckenschere auf den Sozialstaat losgehen möchte, bestätigt seine Strategie die alte Wahrheit: Einen schwachen Staat können sich nur die Reichen leisten. Lindner und CDU-Chef Merz verkörpern soziale Kälte und unsoziale Dreistigkeit in Person.
Der Ökonom Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erklärte dieser Tage der FDP, dass 40 Milliarden Euro der von ihr versprochenen Steuerentlastungen beim reichsten Prozent der Bevölkerung ankämen; 21 Milliarden kämen der gesamten unteren Hälfte zugute. Legt man die DIW-Berechnungen für das Wahlprogramm der CDU zugrunde, ergibt sich: Das reichste Prozent würde mit mehr als 33 000 Euro Steuereinsparungen pro Kopf und Jahr profitieren, während Menschen aus der unteren Hälfte der Einkommenspyramide im Durchschnitt nur um rund 290 Euro entlastet würden.
Wenn es um sozialpolitische Wohltaten geht, werden gern mal einkommensschwache Gruppen gegeneinander ausgespielt oder sogar aufgebracht. Das ist so bei der von Wirtschaftsfunktionären, Unions- und FDP-Politikern unentwegt betätigten Leier, Arbeit lohne sich nicht, wenn Menschen es sich im Bürgergeld gemütlich machen könnten. Eine andere Variante: Neidkampagnen gegen Flüchtlinge. Die BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht rechnete einmal vor, dass der deutsche Staat für jeden Asylbewerber im Monat 1700 Euro aufwendet. »Erklären Sie mal einer Rentnerin, die ihr Leben lang hart gearbeitet hat, die zwei Kinder großgezogen hat, die von einer Rente von 1700 Euro nur träumen kann, diese Ausgaben!« – so suggerierte Wagenknecht, dass jeder Migrant diesen Betrag in seiner Tasche hat. Tatsächlich erhalten erwachsene Asylbewerber je nach Familienstatus um die 400 Euro für ihren Lebensunterhalt, der große Rest sind etwa Wohn- und Verwaltungskosten.
Am Ende geht es immer um die sogenannte Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Deshalb hatten Politikdeuter erwartet, dass vor der Bundestagswahl 2025 ein Wirtschaftswahlkampf stattfindet. Wie sich immer deutlicher abzeichnet, geht es in der Konsequenz oft um Druck gegen Schwache und um gesellschaftliche Spaltung. Man könnte auch sagen: um Ausbeutung und Profitsicherung. Und damit ist noch nicht einmal die Rede davon, dass das Lebensniveau in Industriestaaten wie Deutschland zu einem guten Teil auf Kosten des armen Teils dieser Welt gesichert wird.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.