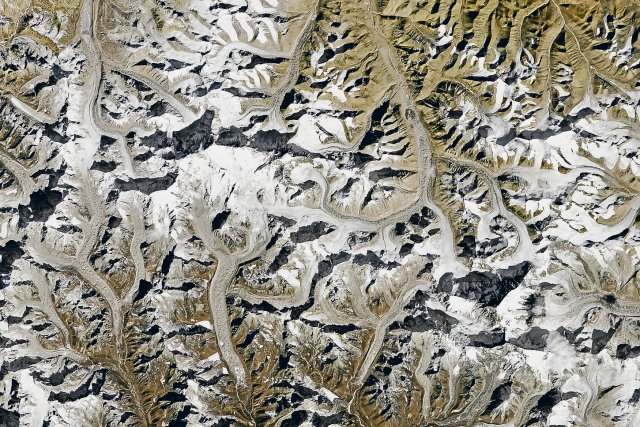- Wissen
- Biotechnologie
»Wir fragen nach den Risiken«
Isabelle Bartram informiert beim Gen-ethischen Netzwerk kritisch über Gentechnik in der Medizin

Frau Bartram, Sie waren damals noch nicht dabei, aber wie ist das Gen-ethische Netzwerk entstanden?
Das Gen-ethische Netzwerk wurde 1986 gegründet. Es war eine Zeit, in der ganz viel passiert ist in Sachen Biotechnologie, Reproduktionstechnologie, Gentechnologie. Es wurde daran geforscht, Pflanzen gentechnisch zu verändern und freizusetzen. Im Bereich der Reproduktionstechnologien wurden zum Beispiel neue pränatale diagnostische Methoden weiterentwickelt. Für die Gesellschaft und auch linke Bewegungen war es schwierig zu verstehen, was aus technischer Sicht überhaupt passiert und welche potenziell schädlichen Auswirkungen das haben kann. Es bestand der Wunsch, Informationen zu übersetzen und zu verbreiten, um schließlich mitreden und mitentscheiden zu können. Deshalb wurde dann der Verein Gen-ethisches Netzwerk gegründet – von Leuten aus dem ökologischen Spektrum, Feministinnen und der Behindertenrechtsbewegung.
Wie sind Sie zum Netzwerk gekommen?
Ich habe Biologie studiert und gleichzeitig habe ich mich in queerfeministischen Kontexten engagiert. Zunächst habe ich das nicht zusammengedacht. Dann gab es einen Punkt, an dem ich in Kontakt gekommen bin mit Menschen, die sich kritisch mit Rassismus in den Lebenswissenschaften beschäftigt haben. Damals gab es an der Humboldt-Uni einen Biologieprofessor, der erzählt hat, es gebe Menschenrassen. Dagegen hat sich eine Initiative von Studierenden gegründet.
Isabelle Bartram ist promovierte Molekularbiologin. Seit 2017 arbeitet sie für das Gen-ethische Netzwerk e.V. im Bereich Medizin. Es informiert kritisch und wissenschaftlich fundiert über Entwicklungen im Bereich der Biotechnologie. Bartram beschäftigt sich insbesondere mit Genome Editing am Menschen, Gendiagnostik, Genomforschung und genetischem Datenschutz. Sie schreibt auch als Gastautorin für »nd.Die Woche«.
Wann war das?
2005. Nach meinem Studium habe ich dann an der Charité promoviert, in der Krebsforschung, und im Labor mit Zelllinien gearbeitet. Dabei habe ich aber gemerkt, dass ich auf die Art, wie das Wissenschaftssystem funktioniert, nicht arbeiten möchte. Nach meinem Eindruck ging es weniger um die Qualität der Forschung und darum, ob Therapien entwickelt werden, die Menschen helfen. Sondern es ging vor allem um Publikationen, Lebensläufe und darum, wie häufig jemand zitiert wird. Mir hat die Motivation gefehlt, so weiter zu arbeiten. Deswegen habe ich überlegt, wie ich mich kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen kann und habe das Gen-ethische Netzwerk gefunden. Zuerst habe ich ehrenamtlich mitgearbeitet und dann habe ich dort eine Stelle im Medizinbereich bekommen.
Wie ist im Netzwerk das Verhältnis von Ehrenamt zu bezahlter Mitarbeit?
Vorstand und Beirat sind ehrenamtlich. Das sind Leute, die dem Verein schon sehr lange verbunden sind und ihre fachliche Expertise einbringen. Die Leute, die in der Geschäftsstelle arbeiten, werden alle bezahlt. Früher sehr prekär; vergangenes Jahr haben wir uns eine Gehaltserhöhung geben müssen, einfach weil es nicht zum Leben gereicht hat. Im Vergleich zu dem, was ich in der Wissenschaft verdienen würde, ist es immer noch sehr wenig. Wir machen die Arbeit, weil es uns wirklich um die Inhalte geht und nicht darum, Geld zu verdienen.
Es tut sich ja in den vergangenen Jahren unglaublich viel in der molekularbiologischen Forschung. Da sind Sie bestimmt schon sehr damit beschäftigt, an der Entwicklung dranzubleiben.
Wir haben eine Person für Landwirtschaftsthemen und zwei Personen, die sich mit Medizinthemen beschäftigen. Im Landwirtschaftsbereich gibt es zum Teil auch andere Organisationen, die zu Gentechnik arbeiten, aber bei vielen Medizinthemen sind wir die einzigen. Wir gucken uns die Studien an, schon lange bevor die Inhalte auf der politischen Tagesordnung stehen. Wir verfolgen die Entwicklungen von ersten Ideen aus der Wissenschaft bis zu Anwendungsideen und zur Technologieentwicklung. Politische Entscheidungen, zum Beispiel, was die Krankenkasse bezahlt, kommen ja erst viel später. Es geht um Fragen, die den Kern der Gesellschaft berühren, zum Beispiel das Thema Genome Editing. In der Wissenschaft wird darüber diskutiert, ob man menschliche Embryonen genetisch verändern sollte. Das würde zu genetisch veränderten Kindern führen mit der Begründung, bestimmte Krankheiten oder Behinderungen verhindern zu können.
Wird so etwas schon gemacht?
Es gab einen Versuch eines chinesischen Wissenschaftlers, aus dem genetisch veränderte Kinder hervorgingen; das war ein Skandal. Aber es gibt auch Wissenschaftler*innen, die Ähnliches in vermeintlich seriösen Studien fortführen möchten. Bis jetzt gibt es noch keine klinischen Studien, aber wir versuchen, vorher zu intervenieren. Wir fragen, warum etwas überhaupt gemacht werden soll und was die Risiken sind.
Beim Genome Editing kommt die sogenannte Genschere Crispr/Cas zum Einsatz. Ist sie denn so präzise, wie immer behauptet wird?
Nein. Auf EU-Ebene wird zwar gerade darüber diskutiert, Genome Editing in der Landwirtschaft nicht mehr zu regulieren, weil es so präzise sei, also Risikoprüfung und Kennzeichnung abzuschaffen. Aber im Medizinbereich ist eigentlich klar, dass die Technologie gar nicht so präzise ist. Viele Studien zeigen, dass sehr viele nicht gewollte Effekte entstehen.
Es gibt ja erste zugelassene Therapien gegen seltene und schwere Erkrankungen, die Genome Editing beinhalten. Werden Risiken in solchen Fällen eher in Kauf genommen, weil eben die Krankheiten so schwerwiegend sind?
Ich denke, wir müssen immer genau und differenziert argumentieren und nicht allgemein die Wissenschaft schlecht machen. Es ist nicht so, dass ich gegen Gentechnik bin. Ich denke nur, wenn veränderte Organismen in Ökosystemen freigesetzt werden und nicht mehr zurückgeholt werden können, muss man vorsichtiger sein als bei begrenzten Anwendungen. Bei schweren Erkrankungen, für die es sonst keine guten Therapien gibt, kann man über solche Ansätze nachdenken, wenn die Leute über die Risiken aufgeklärt werden. Es sind allerdings wahnsinnig teure Therapien. Da wären meine Kritikpunkte eher: Warum sind sie so teuer? Wie steht es mit der Verteilungsgerechtigkeit?

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Bei welchen Themen sehen Sie gerade Informationsdefizite in der Öffentlichkeit?
In einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt wird zurzeit überlegt, die Genome aller Neugeborenen in Deutschland zu sequenzieren und die Daten möglicherweise für weitere Forschung zu speichern. Das Ganze steht im Kontext von weltweiten ähnlichen Projekten. Bei Neugeborenen-Screenings kann man schon jetzt nach einigen schwerwiegenden Erkrankungen suchen, um diese zu behandeln, schon bevor die Symptome einsetzen. Die Idee ist, dass man potenziell auf Hunderte oder Tausende Erkrankungen testen könnte. Einige denken, es könnte auch bei der Familienplanung helfen, wenn die Eltern beim nächsten Kind schon wissen, dass bestimmte genetische Erkrankungen auftreten können. Da stellen sich ganz neue ethische Fragen und da müsste die Öffentlichkeit eigentlich viel mehr mitsprechen. Eine so entstehende nationale DNA-Datenbank könnte ja auch Begehrlichkeiten wecken, zum Beispiel bei Ermittlungsbehörden.
Ist da auch wieder eine Suche nach angeblichen Kriminalitätsgenen zu befürchten?
Man muss es zumindest mitdenken. Die Forschung zur Vererbung von Verhalten und Persönlichkeit ist nicht totzukriegen. Inzwischen hat man Gesamtgenomanalysen mit viel mehr Daten. Es werden nicht mehr nur einzelne Genvarianten mit Eigenschaften korreliert, sondern viele Millionen Genvarianten. Das ist schon etwas, womit sich auch linke Bewegungen beschäftigen sollten. Unsere Aufgabe als Gen-ethisches Netzwerk ist es, diese Sachen sichtbar zu machen.
Welche Kanäle nutzen Sie dafür?
Unser zentrales Medium ist unsere Zeitschrift »GID«. Da wie überall der Bedarf an Printmedien zurückgeht, stellen wir auch alles online. Aber zum einen wollen wir Informationen verbreiten, andererseits müssen wir von irgendetwas leben. 40 Jahre lang sind wir dabei politisch unabhängig gut durchgekommen. Wir leben vor allem von Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Abo-Beiträgen. Aber die Konkurrenz um Spenden ist größer geworden und die Spendenbereitschaft geht insgesamt zurück. Mit einem Rettungsaufruf konnten wir zunächst das gröbste Loch stopfen. Aber wir brauchen weiter kontinuierliche Unterstützung.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.