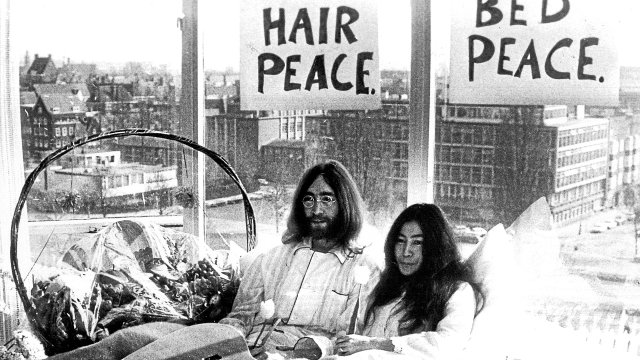- Kultur
- Politisches Buch
Worin wir irrten ...
Die Militärakademie in Dresden – eine selbstkritische Rückschau
Selbstaufklärung und Neubewertung – mit dem Wissen von heute«, so umriss Wolfgang Scheler das Anliegen einer Tagung zum 50. Jahrestag der Gründung der Militärakademie »Friedrich Engels«, deren Ergebnisse nun in einem umfangreichen Sammelband vorliegen. Angesichts der politisch wohlfeilen Pauschalurteile über die DDR zwei Jahrzehnte nach dem Krisen- und Wendejahr 1989 und der im Gegenzug gepflegten Rechtfertigungen nötigt die hier praktizierte Rückschau auf eigene Tätigkeit, deren Möglichkeiten und Grenzen, Respekt ab. Die Dresdener Studiengemeinschaft Sicherheitspolitik e. V. erbringt seit Jahren wichtige Vorleistungen zu einem »besseren Verständnis des ostdeutschen Militärs«, wie Rüdiger Wentzke vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr lobt. Genau hier liegt das Problem, das über den Gegenstand hinausreicht. Untersuchungen, die in Vorurteilen verharren, erschweren das Verständnis der DDR-Gesellschaft und ihrer Nachwirkungen ebenso wie nachträgliche Rechtfertigungen.
Brigadegeneral a. D. Hermann Hagena stellt deshalb das »Bild vom NVA-Soldaten als eines seelenlosen Partei-Apparatschiks und Mauermörders« in Frage. Das geschichtliche Urteil über die NVA ist für ihn offen. Auch der Brigadier i. R. Gerhard L. Fasching aus Österreich drückte seinen Unmut darüber aus, mit welcher Ignoranz man der Westen bei der Abwicklung der NVA vorging. Ernsthafte Politik sollte nach 20 Jahren staatlicher Einheit an wissenschaftlich tragfähigen und belastbaren Befunden interessiert sein.
Paul Heider skizziert die Entwicklung der Militärakademie von 1959 als Kaderschmiede bis zum Impulsgeber für eine demokratische Militärreform 1990. Wolfgang Scheler beleuchtet das widersprüchliche Verhältnis von Ideologie, Militär und Wissenschaft. Sein Fazit lautet, dass es »letztlich erst des praktischen Scheiterns der Gesellschaftsform, für deren Verteidigung wir einstanden, und damit der tiefen Erschütterung unserer früheren Gewissheiten« bedurfte, »um zu erkennen, worin wir irrten«. Max Schmidt arbeitet den Anteil der Militärakademie an der Entwicklung der Friedensforschung der DDR heraus, der sich noch 1989 in dem Buch »Frieden – Krieg – Streitkräfte« dokumentierte und mit einem Paradigmenwechsel im militär- und sicherheitspolitischen Denken verbunden war. Siegfried Schönherr berichtet über die Erfahrungen, die sich aus der Aufgabenstellung zur Konversion der Streitkräfte und Rüstungen ergeben. Rolf Ziegenbein geht auf die Probleme und Konflikte ein, die sich aus den prinzipiellen Unterschieden zwischen polizeilichen und militärischen Aufgaben für die Ausbildung von Grenzoffizieren ergaben. Die Grenzsicherung den Regeln der Gefechtsführung unterzuordnen, sei in Theorie und Praxis falsch gewesen. Grenzdienst wurde so zum Gefechtsdienst erklärt – mit entsprechenden Weiterungen. Im Beitrag von Hermann Hagena wird noch einmal daran erinnert, dass die Bundeswehr bei den Verhandlungen zum Einigungsvertrag die doppelte Aufgabe – Reduzierung der eigenen Streitkräfte bei gleichzeitiger Auflösung der NVA – zu ihren Gunsten lösen konnte, weil den damals Verantwortlichen der DDR-Seite »die Vertretung der Interessen der eigenen Berufssoldaten im Einigungsvertrag … gleichgültig war«.
Die 25 Beiträge, denen ein Geleitwort des letzten Chefs der NVA, Admiral a. D. Theodor Hoffmann, vorangestellt ist, reichen von militärtechnischen Fragen über das Bild vom Gegner bis hin zu Erfahrungsberichten aus den Jahren der Neuorientierung 1989/90. Sie liefern allemal ausreichend Material für eine sachorientierte Diskussion zum Platz der Nationalen Volksarmee in der deutschen Militärgeschichte.
Militärakademie »Friedrich Engels«. Historisch-kritische Nachbetrachtung zum 50. Jahrestag ihrer Gründung. DSS-Arbeitspapiere. (ISSN 143-6010), 309 S., br., 10 €.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.