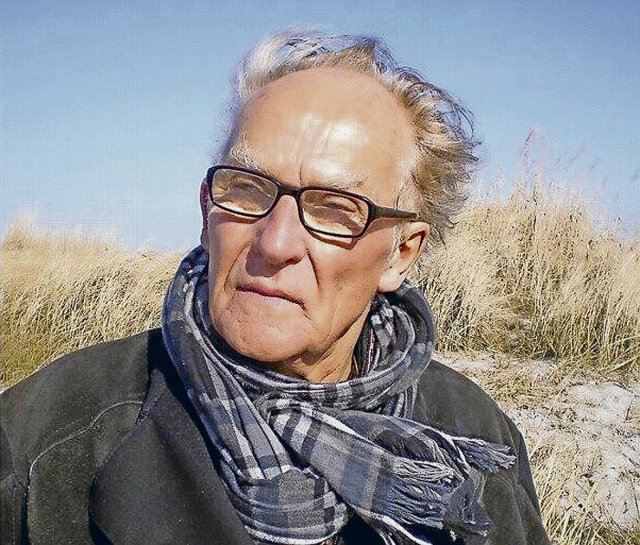Bitterer Brunnen des Herzens
Heute wäre der große Dichter Paul Celan 90 Jahre alt geworden
Ein großer Dichter, 1920 in Cernowitz geboren, 1970 in Paris gestorben. Freitod in der Seine. Der vermutlich letzte Aufenthalt Paul Celans im Leben: jene »Brücke der Jahre«, Pont Mirabeau, die in einem Gedicht Apollinaires vorkommt und sich leitmotivisch durch Briefe zieht, die Celan über Jahre hinweg seiner Frau Gisèle geschrieben hatte. Auf seinem Schreibtisch hinterlässt er eine Hölderlin-Biografie, aufgeschlagen die Seite mit einem unterstrichenen Zitat von Clemens Brentano: »Manchmal wird dieser Genius dunkel und versinkt in den bitteren Brunnen seines Herzens.«
Es war im Jahre 1948, dass im Lyrikband »Der Sand aus den Urnen« – Celan zog ihn später zurück – das bald berühmt werdende Gedicht »Todesfuge« erschien. Darin die Verse, die zum Topos antithetischer Sprache wurden: »Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends/ wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts/ wir trinken und trinken/ wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng ... Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts/ wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland.«
»Sie sind«, schreibt Celan an seine Frau, »und das wissen Sie genau, die Frau eines Poète maudit, doppelt und dreifach Jude«. Das meint nicht nur das Judentum als Wurzel, das meint den Tod der Eltern im Konzentrationslager und schließlich das abweisende Schicksal, das ihm in Deutschland zuteil wird – als einem Dichter, dem auf erschütternd tiefe wie fremde Weise Lyrik nach und »mit« Auschwitz möglich ist.
Auf einer Tagung der »Gruppe 47«, auf der er die »Todesfuge« liest, mokiert man sich über seinen deklamierenden Ton. Der lese ja wie Goebbels, sagt einer, und Celan vermutet, dass man ihn am liebsten stumm sähe. Der versteckte Antisemitismus der »Linksnibelungen im Magnetfeld dieser Gruppe« einerseits, der offensichtliche Restaurationston der Adenauer-Ära andererseits – Celan wird, neben seinem depressiven Leiden, auch daran zerbrechen. (1956 wird für die Filmfestspiele Cannes Alain Resnais’ Streifen über die NS-Vernichtungslager »Nacht und Nebel« nominiert, den Filmtext hatte Celan ins Deutsche übertragen – daraufhin bewirkt die Bundesregierung eine Absetzung des Streifens, weil er »Hass auf das deutsche Volk in seiner Gesamtheit« erzeuge.
Der dreifache Jude, der verfluchte Dichter. Nur gemach ihr da draußen, so schreit sein Leben, nur gemach – ihr leicht Fertigen mit allem, was war und doch so hartnäckig dableibt, wartet nur: Ich löse mein Opferschicksal ein. Und so arbeitet er all jenen, die leichten Gewissensschlaf finden, gewissermaßen heftigst zu; er wird schwächer und dünnhäutiger – er dichtet gleichsam am eigenen Verschwinden. Seiner Frau reißt er eines Tages ein gelbes Tuch vom Kopf, weil es ihn an den Judenstern erinnert. Wenig später wird er erstmalig in die Psychiatrie eingewiesen. Anderthalb Jahre verbringt Celan in seinen letzten acht Jahren in Kliniken, die Liebe zu Gisèle nun »zwangsjackenschön«.
Dies Leben: eine Liebesgeschichte. In der Gisèle nie abwesend sein wird, just dort nicht, wo Celan Abbruch und Außersichsein lebt, eine Geschichte, in der Ingeborg Bachmann auftaucht, jäh und lodernd. Und andere Frauen. Auch Briefe zwischen Celan und Nelly Sachs erzählen die Geschichte zweier gleichgesinnt und gleichgestimmt Leidender, die nie zusammenfanden.
Die Geschichte dieses Dichters, der seinen Familiennamen Ancel – anagrammatisch – in Celan änderte, ist aber auch die Erzählung über eine fast unbekannt gebliebene europäische Kulturlandschaft, die Bukowina. Deren Juden in alle Welt verstreut wurden. Deren politisches Wechselschicksal – rumänisch, sowjetisch, nazideutsch, wieder sowjetisch, wieder ukrainisch – die erschreckend gewöhnlich gewordene Zerrissenheit eines Jahrhunderts widerspiegelt. »Es ist die Landschaft, in der ein nicht unbeträchtlicher Teil jener chassidischen Geschichten zu Hause war, die Martin Buber uns allen auf deutsch wiedererzählt hat ... eine Gegend, in der Menschen und Bücher lebten« (Celan). Hier verbringt Celan, der »karpatisch Fixierte«, fast die gesamte erste Hälfte seines Lebens. Dichten wird er in der »Mördersprache« – aber so, dass die Sprache selber zur rätselmutigen Gegenwelt wird, unerreichbar von einem gängigen deutschen Bewusstsein, das doch weit Unbegreiflicheres hervorbrachte: Auschwitz.
Über Wien kam Celan 1948 nach Paris, bleibt in der Stadt. Lernt seine Frau kennen. Findet ein zitterndes Zentrum für eine doch unstabil bleibende Existenz. Für ein Jahr wird er mit Gisèle in die Bretagne gehen, und aufscheint der beglückende Verdacht, es gelänge eine Flucht in die Niemandsbucht. Nichts gelingt. Ein Krieg war überstanden, aber es blieb ein Schmerz aus »Kält und Finsternissen« (Heinrich Böll) – man kann davongekommen sein und das Glück entfernter denn je empfinden.
Deutschland war das Land von Celans Muttersprache, ein Lebensraum konnte es ihm nie werden. Spät noch – und naturgemäß vergeblich – hofften enge Freunde, ein Umzug nach Freiburg, eine Lektorenstelle an der dortigen Universität würden dem Gefährdeten helfen. Zudem er sein Leben in Paris, seit er sich von seiner Frau und seinem dreizehnjährigen Sohn getrennt hatte, mehr und mehr als Isolation empfand. Aber eine Übersiedlung dorthin, in die »Angstlandschaft«, wo er auf Schritt und Tritt mit Vergangenheit konfrontiert würde? Dorthin, wo er auf Menschen träfe, deren Erfahrungen seinen eigenen, denen seiner Gedichte, so entgegengesetzt wären? Unmöglich. Lieber echolos bleiben. Ohnmächtig. Scheiternd. Einsam. Düster. Bitter. Bis nichts mehr rettet vor dem Verstummen. Bis es einem den Atem verschlägt und »Atemwende« – so der Titel eines seiner Bücher – unmöglich wird.
Der Pariser Mai 1968, das Erlebnis rebellierender Studenten, die Protestbewegung der deutschen Universitätsjugend sowie die Zerschlagung des Prager Frühlings – für Celan eine Konstellation von Ereignissen, die zutiefst das Thema seiner Jugend betrifft: das Verhältnis von autoritärer Macht und den Ohnmächtigen. Es war der Übergang Rumäniens zur »rigiden Volksdemokratie«, die Celan einst zur Flucht gedrängt hatte. Stalinismus, der »verscharrte Oktober«. Nie wieder war er in ein Land des Ostblocks gereist, nie wieder hatte er den Boden des geliebten Czernowitz betreten. Aber, die »Internationale« singend, zieht er mit durch die Straßen des Pariser Mai. Er liest mit dem dreizehnjährigen Sohn Eric Kropotkin und Landauer, das »No pasaran« des Spanischen Bürgerkrieges ist ihm bleibend ein Fanal für Visionen von einer »Erhebung der Kreatur« – das ist der Dichter, dessen Einsamkeit so groß war wie seine Sehnsucht nach Gemeinde.
Dass Achtundsechzig zur Enttäuschung geriet, in Paris wie in Prag und ebenso in Deutschland, wo die so Unautoritären in die Gewalt abdrifteten – Celan hat es seinem Sohn als Mahngedicht ins Gewissen geschrieben: »In der Flüstertüte/ buddelt Geschichte,// in den Vororten raupen die Tanks,// unser Glas/ füllt sich mit Seide, // wir stehn.«
Einmal noch war dieser Biografie eine Tür aufgetan, die ins Begütigende zu führen schien. 1969 fliegt Celan nach Jerusalem. Nach Czernowitz und Paris der dritte wirkliche Lebensort. »Ich brauche Jerusalem, wie ich es gebraucht habe, ehe ich es fand.« Aber er flieht Israel nach einer Begegnung, die herzlich gemeint war: mit der Czernowitzer Landsmannschaft. Die fordernde Hautnähe des Einstigen, doch so lange und tief ersehnt, legt nur wieder den Einsamkeitsnerv betäubend schmerzvoll offen. Er ist dazu verdammt, alles zu fliehen, was seine Fremdheit mildern könnte. »Ich muss Waise bleiben.«
Celan war. Längst erdrückt die Auslegungsliteratur das zarte Werk der Bände »Fadensonnen«, »Lichtzwang«, »Schneepart«; die sekundärliterarische Wucht stärkt das Urteil, diesem schwierigen Dichter könne man nur mit Hilfe von Gebrauchanweisungen nahe kommen. Aber schon Celan bat selber, ohne jede Koketterie: »Lesen Sie! Immerzu nur lesen, das Verständnis kommt von selbst.« Seine Sprache sei (zu) dunkel? Richtig daran ist, dass man, wo es zu dunkel wird, nichts mehr sieht. Umgekehrt gilt: Wo es zu hell wird, geschieht Blendung. Celans Dichtung ist – durchsichtig. Wer seine Verse liest, schaut nicht auf eine Mauer, sondern blickt, wie durch ein Gitter, durch die Sprache hindurch. Das Wort des Dichters verengt sich nicht zum nutzbaren Begriff; das Wort schließt nicht ab, so wie man Verträge abschließt, es schließt auf, es wird vertragsbrüchig. Das Gedicht kann dann »durch die Zeiten hindurchgreifen – durch die hindurch, nicht über sie hinweg«, wie Celan 1958 bei der Entgegennahme des Bremer Literaturpreises sagte.
Und wohin greifen? Dorthin, wo Wirklichkeit wahrhaft stattfindet – im Entwurf. Der Lohn: die »Blume der Zeit«. Wenn wir auch nicht wissen, wo sie blüht und ob es sie überhaupt gibt, es ist ein anstrengungsschöner Genuss, Celan bei Behauptung und Suche zu folgen.
Gernot Wolfram: Paul Celan – Der Dichter des Anderen. Reihe »Jüdische Miniaturen«, hrsg. Von Hermann Simon. Verlag Hentrich & Hentrich Berlin, 70 S., brosch., 6,90 Euro
IRISCH
Gib mir das Wegrecht
über die Kornstiege zu deinem Schlaf,
das Wegrecht
über den Schlafpfad,
das Recht, dass ich Torf stechen kann
am Herzhang,
morgen.
*
DER DURCHSCHNITTENE Taubenkordon,
die gesprengten Blütengewalten,
die tatverdächtige
Fundsache Seele.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.