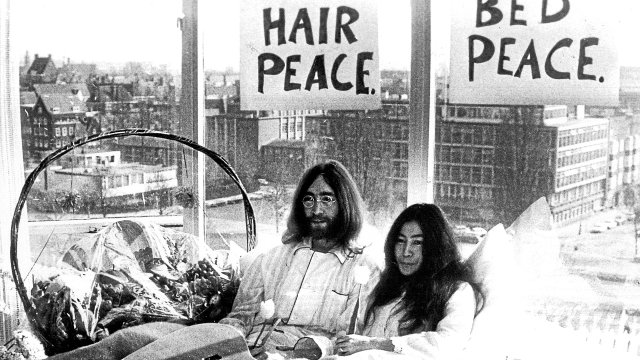Das Fürchten verlernen
Wolfgang Herrndorf erzählt von einer Reise, die alles verändert
Es gibt viele Gründe, ein Buch zu loben. Aber es gibt nur einen Grund, ein Buch von der ersten bis zur letzten Seite in einem Zug zu lesen: das Glück, ganz darin einzutauchen. Wolfgang Herrndorfs Roman »Tschick« erzeugt diesen Sog – undenkbar, dass jemand ihn, einmal begonnen, einfach zur Seite legt. Das ist so unmöglich wie die Vorstellung, bei voller Fahrt auf der Autobahn könne man sich entscheiden, doch lieber zu Hause geblieben zu sein.
»Tschick« ist ein Jugendbuch in dem Sinne, dass die Beweglichkeit seiner jugendlichen Helden die Leser, gleich welchen Alters, erfasst. Vielleicht ist ein Ausbruch aus den Gittern gesellschaftlicher Normen, wie er hier von zwei Vierzehnjährigen durchlebt wird, tatsächlich Pubertierenden vorbehalten. Vielleicht aber eben auch nicht.
»Tschick« handelt von der Verwirklichung der Idee, ein Leben ohne Angst zu führen. Je weiter sich Maik Klingenberg und Andrej Tschichatschow im gestohlenen, nein: geborgten Lada Niva aus den Klauen ihres vorgezeichneten Lebens befreien, desto mehr finden sie zu sich selbst und zueinander. Desto mehr vor allem nähern sie sich einer greifbaren Ahnung davon, was das wirklich sein könnte: Glück, Liebe. Eine Befreiung aus der Lähmung des Immergleichen ist ihre abenteuerliche Spritztour durch Ostdeutschland.
Natürlich endet sie jäh: Polizei, Krankenhaus, Gericht. Aber nichts ist danach, wie es war. Wolfgang Herrndorf lässt seine Helden einen Wandel vollziehen, eine Metamorphose von still ertragenden zu selbstbewusst handelnden Menschen. Nicht umsonst nehmen die Gymnasiasten am Anfang des Buches im Deutschunterricht Brechts berühmteste Keuner-Geschichte durch: »Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: ›Sie haben sich gar nicht verändert.‹ – ›Oh‹, sagte Herr K. und erbleichte.«
Maik Klingenberg erzählt uns, was geschehen ist, in der bruchstückhaften, bildreichen Sprache des Jungen, der er ist: ein Achtklässler aus Berlin Marzahn-Hellersdorf, einer Gegend, in der Eigenheim-Siedlungen an Plattenbau-Mietblocks grenzen und soziale Milieus zusammentreffen, die andernorts durch tiefe Gräben getrennt sind. Maik, in der Wahrnehmung seiner Mitschüler ein unscheinbarer Langweiler, lebt hinter der äußerlich unversehrten Fassade seines kleinbürgerlichen Elternhauses; der Vater ein insolventer Bauunternehmer, die Mutter eine tennisspielende Alkoholikerin – Leute, »die gerne unglücklich sind« (Maik). In den großen Ferien lassen die Eltern den Sohn allein – sie begibt sich auf Entzug in die »Beauty Farm«, er auf »Geschäftsreise« mit der hübschen Sekretärin, die gerade fünf Jahre älter ist als das eigene Kind.
Abzusehen sind für diesen Maik sechs einsame Wochen zwischen Chipstüten, Computerspielen, Swimmingpool und Rasensprenger – und voller Sehnsucht nach Tatjana Cosic, die nichts davon ahnt, dass er in sie verknallt ist. Jeder Depp ist zu Tatjanas Geburtstagsfeier eingeladen, bloß Maik nicht – und nicht Tschick. Tschick, eigentlich Andrej Tschichatschow, ist der neue in der Klasse: ein wortkarger, elternloser Spätaussiedler, den ein Ruch von Schnaps und Unberührbarkeit umgibt. Nicht mal die Lehrer kommen an den »Russen« ran. Aber dann steht just dieser Tschick vorm Gartentor der Klingenbergs – im geklauten Lada. Und alles kommt ganz anders, als es eigentlich kommen müsste.
Zuerst fahren die Unerwünschten zu Tatjanas Party, wo der schüchterne Maik es schafft, seiner verblüfften Angebeteten das Bleistift-Porträt ihrer Lieblingssängerin in die Hand zu drücken, an dem er wochenlang gearbeitet hatte. Dann Reifenquietschen und weiter ins Blaue. Wohin genau? In die Walachei, schlägt Tschick vor, er habe dort einen Großvater. Maik: »Das ist nur ein Wort, Mann. [...] Walachei ist nur ein Wort! So wie Dingenskirchen. Oder Jottwehdeh.« Eine Reise ins Nirgendwo also? Nun denn.
Die Landschaften, die Maik und Tschick durchkreuzen, sind fabelhaft: Weizenfelder, Bergbaubrachen, Asphaltwüsten. Die Menschen, denen sie begegnen, sind nicht von dieser Welt: ein bewaffneter Einsiedler, eine kinderreiche Ökofamilie, eine hilfsbereite Sprachtherapeutin. Was über all diese Menschen zu sagen ist, sagt Maik am Ende des Ausflugs: »Seit ich klein war, hatte mein Vater mir beigebracht, dass die Welt schlecht ist. Trau keinem, geh nicht mit Fremden und so weiter. Das hatten mir meine Eltern erzählt, das hatten mir meine Lehrer erzählt, und das Fernsehen erzählte es auch. [...] Und vielleicht stimmte das ja auch, und der Mensch war zu 99 Prozent schlecht. Aber das Seltsame war, dass Tschick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem einen Prozent begegneten, das nicht schlecht war.«
Die unwahrscheinlichste aller Gestalten, die Maik und Tschick kennenlernen, ist Isa. Ein entfesseltes, ganz und gar freies Mädchen, das in einem Schrank auf der Müllhalde lebt und die beiden Ausreißer eine Weile begleitet. Isas unfassbare Schönheit ist unter einer dicken Schicht aus Dreck und Gestank verborgen. Im eisigen Wasser eines kristallklaren Bergsees fällt diese Schicht ab wie Isas verfilzte Haare, als Maik sie ihr schneidet. Man könnte diese Erscheinung für einen Traum halten – erhielte Maik nicht längst nach dem Ende des Abenteuers einen Brief von ihr.
Aus nichts anderem als daraus, das vermeintlich Unveränderliche mit großer Überzeugungskraft gegen das unwahrscheinlich Bewegliche auszutauschen, resultiert die ganze Faszination dieser Geschichte. Das, was hier beim Kurzschließen unseres Ladas elektronisch vor sich geht, hat nichts mit dem zu tun, was wir im Physikunterricht gelernt haben, denkt Maik einmal. Dass es trotzdem funktioniert, könnte heißen, dass wir in einer Parallelwelt gelandet sind. »Dabei war wahrscheinlich der Physikunterricht die Parallelwelt.«
Möglich, sagt Herrndorfs wundervoller Roman, ist das, was wir tun. Und tun können wir viel mehr, als uns der scheinbar unentrinnbare Alltag glauben macht. »Weil, man kann zwar nicht ewig die Luft anhalten. Aber doch ziemlich lange.«
Wolfgang Herrndorf: Tschick. Rowohlt Berlin, 256 S., geb., 16,95 €.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.