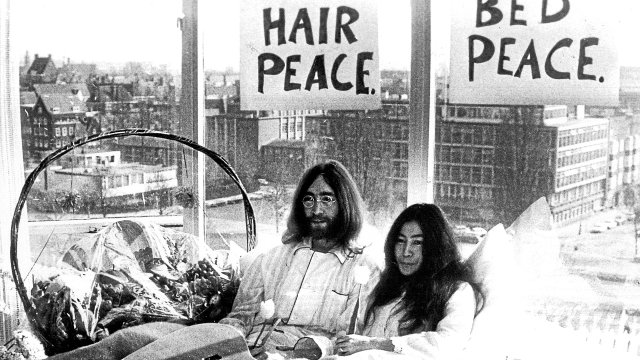- Kultur
- Buchmesse Frankfurt am Main
Das Malerleben einer Frau
RENATE FEYL erzählt von Elisabeth Vigée-Lebrun
Elisabeth Vigée-Lebrun, die Frau im Mittelpunkt von Renate Feyls neuem Roman, wurde in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts in Frankreich eine der berühmtesten Malerinnen Europas. Allerdings auch eine Verfolgte, Exilierte, mit dem Tode Bedrohte. Das Schicksal ihres Landes, das Europa 1789 mit der Französischen Revolution erschütterte, griff auch nach ihr. Dabei gehörte Elisabeth Vigée alles andere als der Aristokratie an, deren Herrschaft zu stürzen das Ziel der Revolutionäre war.
Elisabeth Vigée wurde 1755 als Tochter eines Pastellmalers und einer Friseuse in Paris geboren. Dem talentierten Kind sagte der Vater eine Zukunft als Malerin voraus, die Tochter zeichnete selbst in ihren Heften und auf den Wänden der elterlichen Wohnung. Bereits mit 15 Jahren verdiente sie mit professionellen Porträts Geld. Im Hintergrund des Mädchens der berühmte Seemaler Claude Joseph Vernet, der sie förderte.
Renate Feyl erzählt die außergewöhnliche Geschichte der Elisabeth Vigée-Lebrun mit dem Taktgefühl einer Erzählerin für das Historische, die dem Authentischen seinen Platz lässt und in diesem Raum das freie Spiel der Interpretation beeindruckend spielt. Da muss man dann schon sehen, dass der Aufstieg der Elisabeth Vigée-Lebrun ein Aufstieg in den Konventionen der Zeit ist, wie diese ihr Schicksal bestimmen und was sie sind. Überall stößt sie auf das männliche Vorurteil, man verwehrt ihr Ausstellungen, öffentliche Anerkennung, den verdienten Platz in der Königlichen Akademie der Malerei und Skulpturen. Und von dem Mann, den sie im Januar 1776 heiratet, der Maler Jean-Baptiste-Pierre Lebrun, wird sie neben seiner Liebe auch schmerzliche Ablehnung erfahren.
Das besondere Talent der Elisabeth Lebrun als Porträtmalerin kann in diesem zu Ende gehenden 18. Jahrhundert nur die Aristokratie in Frankreich wirklich nachfragen. Der Adel vermag von sich zu sagen: Die Gesellschaft sind wir – wie es von Ludwig XIV. heißt »der Staat bin ich«. Auf diesem Wege dringt Elisabeth Vigée-Lebruns Ruhm auch nach Versailles, wohin sie die Königin Marie Antoinette ruft, um sich von der Berühmten porträtieren zu lassen. Der Eindruck ist so groß, dass nun zahlreiche Aufträge für weitere Porträts Marie Antoinettes und der königlichen Familie folgen. Die Nähe zum Königshaus reißt sie in den Strudel der Revolution und treibt sie als scheinbare Nutznießerin in ein zwölfjähriges Exil.
Es ist eine der interessanten Nahtstellen des Romans, wenn die Nacherzählung der Lebensgeschichte der Malerin übergeht in die erzählerische Interpretation ihrer Kunstleistung. Geschmäht als bloße »Auftragskünstlerin« – da springt ihr Renate Feyl bei und provoziert Nachdenken. Ohne Auftrag hätte Raffael nicht die Sixtinische Madonna gemalt und Michelangelo nicht das Jüngste Gericht. Das Nachdenken ist nüchtern, schließt die Zumutungen der Auftraggeber an die Künstler ein.
Das Exil der Malerin führte durch Holland und Italien. 1795 nahm sie am Zarenhof in St. Petersburg Aufenthalt und blieb dort sechs Jahre, bis sie sich 1801 zur Rückkehr nach Frankreich anschickte, wo sie keine Bedrohung mehr erwartete. Auf der Rückreise aus St. Petersburg hatte sie 1801 einen sechsmonatigen Zwischenaufenthalt am preußischen Hof in Berlin. In dieser Zeit entstand ein Pastell der Königin Luise. Mit ihrem Eintreffen in Paris verlässt Renate Feyl die Lebensgeschichte der Elisabeth Vigée-Lebrun. Das Schicksal, mit dem es die Malerin aufzunehmen hatte, ist erzählt. Elisabeth Vigée-Lebrun stirbt im März 1842 im Alter von 86 Jahren in Paris. Der Roman hat eine Dimension wie dieses Leben. Er entfaltet sich anspruchsvoll auf einem großen Tableau.
Renate Feyl: Lichter setzen über grellem Grund. Kiepenheuer & Witsch. 464 S., geb., 19,99 €
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.