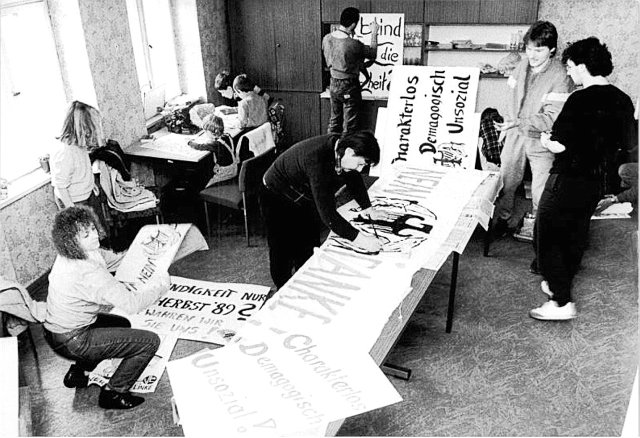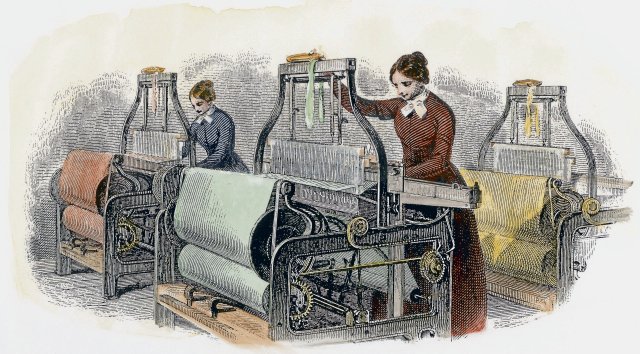- Kultur
- Der vergessene Klassiker vom Wedding - Heute vor hundert Jahren wurde Otto Nagel geboren
Er malte Bilder von den Schattenseiten des Lebens
Otto Nagel: „Der 70. Geburtstag des Waldarbeiters Scharf“, öl
Foto: Archiv
Die Bilder des Malers Otto Nagel senden auf einer Wellenlänge, auf die heute nicht viele Empfänger eingestellt sind. Den einen ist er zu düster, den anderen zu wenig aggressiv. Diese Urteile haben ihm übrigens schon mehrmals geschadet. Seine Berliner Ansichten? Aber doch nicht solche! Zu wenig nostalgisch, zu wenig hektisch, zu wenig Aufbaudynamik. Keine künstlerische Neuerung ist zu entdecken, die die Bildsprache verändert hätte. -In der Tat, er ging behutsam mit dem Überkommenen um. An seinem 100. Geburtstag, siebenundzwanzig Jahre nach seinem Tode, ist Otto Nagel durchaus in Gefahr, vergessen zu werden. Nicht jedes Museum ist stolz, seine Bilder zu zeigen. Freilich, es gibt - wie lange noch? - das Otto-Nagel-Haus am Märkischen Ufer, seit 1973, das zur Nationalgalerie gehört. Das Märkische Museum besitzt Bilder von ihm. Die kleine private Galerie „OM“ am Prenzlauer Berg zeigt einiges Wenig- oder Unbekanntes. Im „Erzählcafe“ in Wedding las am 24. September Erwin Geschonneck aus Nagels Roman „Die weiße Taube oder Das nasse Dreieck“. .Der Tischlersohn vom Wedding hatte sich ja auch als Schriftsteller versucht.
Der Ehrenbürger von Potsdam und von (postum, zusammen mit Heinrich Zille) Berlin
verdient bleibendes Erinnern und neue Fragen. In den zwanziger Jahren schuf er einige der eindringlichsten Darstellungen von Menschen aus den untersten Gesellschaftsschichten. Er kannte ihr miserables Dasein, ihre großen Sorgen und kleinen Träume genau, weil er zu ihnen gehörte. Er malte ihren düsteren Kiez und die spärlichen Lichtblicke im kleinen Park. Aus Einzelporträts und einfachen Szenen setzte er ein soziales Panorama von Schicksalen und Charakteren zusammen - voller Zuneigung oder zumindest Verständnis, aber ganz entschieden ohne idealisierende Verklärung. Die Kämpfer waren nun mal in der Minderheit. Zweimal faßte er eine Anzahl Porträts zu einer neuen Art von Mehrtafelbild zusammen, um die gemeinsame Lage individuell zu differenzieren. Das macht Realismus aus. 1934, als die Nazis dem kommunistischen „Agitator“ bereits verboten hatten, im Atelier zu malen, worauf er eben ins Freie ging, stieß er bei Glienicke-Nordbahn auf den Waldarbeiter Scharf. Er genoß in einem alten Sessel seinen 70. Geburtstag durch ungewohntes Nichtstun. Auf der Stelle entstand ein tragisch-ironisches Meisterwerk der wissenden Analyse und sicheren, unüblich dynamischen Formgebung. Es wird getragen von Achtung vor der Würde des Mitmenschen.
Nach 1945 mißlang es Nagel weitgehend, den „neuen Menschen“ zu malen, der da sein sollte und doch nicht da war. Seine künstlerische Ehrlichkeit geriet in unlösbaren Widerspruch sowohl zu eigenen gutwilligen Illusionen, als auch und in erster Linie zu einer politisch geforderten agitatorischen Schönfärberei. Er erkannte oder fühlte das und gab das Malen bald fast gänzlich auf, um sich energisch wieder seinem zweiten großen Anliegen zu widmen: gemeinschaftliches Handeln für die Kultur zu organisieren und Kunst an ein zu verbreiterndes Publikum zu vermitteln. Er hatte seit 1921 in der „Künstlerhilfe“ für Rußland gewirkt, Ausstellungen in Warenhäusern zuwege gebracht, progressive deutsche Kunst in der Sowjetunion vorgestellt, eine satirische Zeitschrift geleitet und für den proletarischen Film gearbeitet. Am Tage vor Hitlers Machtantritt war er - für zwölf Stunden - zum Vorsitzenden des Reichsverbandes Bildender Künstler gewählt worden.
Jetzt wirkte er leitend im Kulturbund, im Künstlerverband, in der neu gegründeten Akademie der Künste, deren Präsident er von 1956 bis 1962 war. Er gewann wichtige Mitstreiter, veranlaßte bedeutende Ausstellungen, stattete überdies in wichtigen Veröffentlichungen seinen Dank an
Heinrich Zille und Käthe Kollwitz ab.
Seine Vorstellungen mißfielen zusehends der Ulbrichtschen SED-Führung. Das betraf den Umgang mit Künstlern, mit der nationalen Frage und mit dem kulturellen Erbe. Nagel wurde geehrt, aber ignoriert. Vergebens protestierte er 1965 namens der Akademie gegen den Berliner Städtebau, die Sprengung der Schinkelschen Bauakademie, die Zerstörung der historischen Struktur des Fischerkiezes. Während des Krieges hatte er in Pastellen das alte Berliner Zentrum festgehalten, ehe es weggebombt wurde. Jetzt gelangen ihm noch einmal sensible und klar geordnete Pastelle vom Fischerkiez, ehe er weggebaggert wurde.
Der „alte Maler“, so der Titel des letzten seiner vielen eindringlichen Selbstbildnisse, starb am 12. Juli 1967, vier Tage nach dem 100. Geburtstag der von ihm verehrten, ermutigten und immer wieder verteidigten Käthe Kollwitz. Sein Leben und seine Hoffnungen gehören in die Geschichtsbücher, seine Werke nicht in die Depots.
Berlin: Otto-Nagel-Haus, Am Märkischen Ufer 16-18, 1. Oktober 1994 bis 8. Januar 1995, Di-So 9-17 Uhr Galerie „OM“, Stargarder Str. 13, 27. September bis 7 Oktober 1994. Mo-Fr 17-1, Sa-So 14-2 Uhr
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.