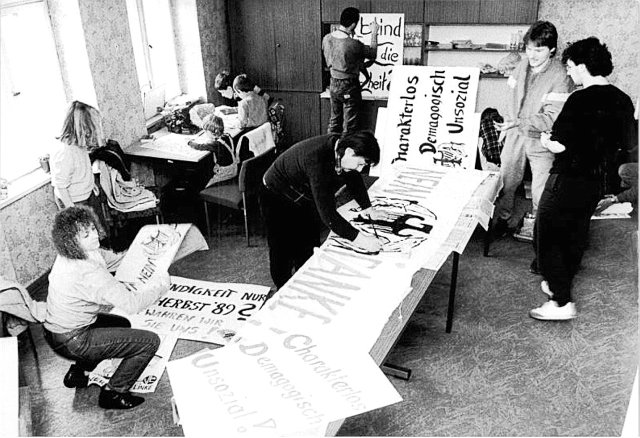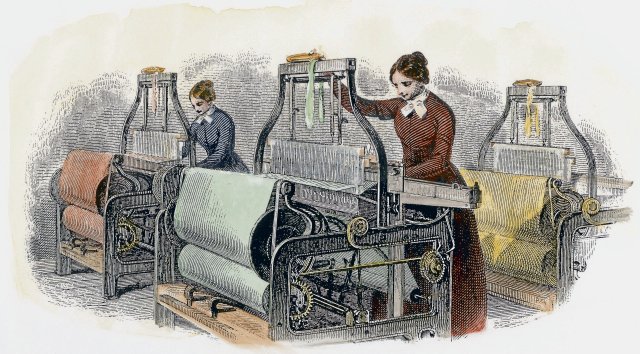- Kultur
- BERNSTEINZIMMER
Grassierender Virus
Seit Jahrzehnten grassiert der Bernsteinzimmer-Virus, insonderheit seit 1986, als Paul Enkes „Bernsteinzimmer-Report“ erschien. Enke war bis kurz vor seinem Tod im Dezember 1987 fest davon überzeugt, das Bernsteinzimmer -Ende 1941 von deutschen Truppen aus Puschkin bei St. Petersburg nach Königsberg verschleppt - liege in Ostdeutschland verborgen. Am 9 Februar 1945 war die „Privatsammlung“ von Erich Koch, „Gauleiter Ostpreußens“ und „Reichskommissar für die Ukraine“, nach Weimar gebracht worden. Koch soll einmal, als er im polnischen Barczewo seine lebenslängliche Haft verbüßte (dort starb er, 90jährig, 1986), geäußert haben, daß auch das Bernsteinzimmer nach Weimar „evakuiert“ worden sei. Daran nun glaubt Enke fest - und mit ihm seither die Westsachsen, ebenso wie die Thüringer aus dem Raum Weimar, Gotha und Arnstadt sowie die Einwohner von Volpriehausen bei Göttingen, namentlich aber der Weimarer Heimatforscher Hans Stadelmann.
Seit 1991 ist nun auch der Leipziger Literat Wolfgang Schneider davon besessen. Er wurde von den Berichten Stadelmanns, der sich seit Jahren um eine ernsthafte Untersuchung des ehemaligen „Gauforums“ an der Weimarer Carl-August-Allee bemühte, gefesselt. Dessen Intention, den Rätseln der dort tief unter dem Rasen liegenden Bunker auf die Spur zu kommen, fand in
Wolfgang Schneider- Die neue Spur des Bernsteinzimmers. Tagebuch einer Kunstfahndung. Gustav Kiepenheuer Verlag, Leipzig 1994. 204 S., 20 Abb., 36 DM.
der DDR wenig offizielles Interesse. Schneider eröffnet, daß sich auch die neuen Landesbehörden Thüringens zu exakter Ergründung des Geländes kaum geneigt zeigten. Die von Stadelmann angegebenen Stellen wurden umgangen, die Arbeiten abgebrochen, ohne die nötigen Tiefen erreicht zu haben. Das Unternehmen im Frühjahr 1992 kostete 93 000 Mark Steuergelder. Der Mißerfolg schien geplant zu sein. Weshalb?
Schneider hat seiner Publikation die Form des Tagebuchs gegeben, so daß der Leser die Sorgen und Leiden eines Kunstfahnders miterleben kann. Der Erkenntniszuwachs bezieht sich freilich weniger auf das Bernsteinzimmer als auf das, was ein „Ossi“ so alles erst verkraften muß, um die Nach-Wende-Welt zu begreifen. Auf eine „neue Spur des Bernsteinzimmers“ vermag Schneider nicht zu weisen. Vielleicht wäre es nicht unangebracht gewesen, wenn er Kontakt zu Experten in Sachen Kunstraub allgemein und Bernsteinzimmer speziell gesucht hätte. Die Informationen, die er präsentiert, sind spärlich. Lesenswert aber ist „Die neue Spur des Bernsteinzimmers“ allemal.
GUNTER WERMUSCH
in die achtziger Jahre des 19 Jahrhunderts noch vornehmlich ein ideologisches Prinzip, wurde so zu einer rechtlichen und administrativen Realität, der immer weniger zu entkommen war Um Einwanderungen zu verhindern, wurden mit Hilfe neuer Techniken an den Staatsgrenzen gewaltige administrative Barrieren errichtet. Diese nationalistische Abschottungspraxis führte dazu, daß bereits im Jahre 1914, nach dem Ausbruch des ersten Weltkrieges, alle Immigranten, die nach Frankreich gekommen waren, im Namen des Prinzips nationaler politischer Homogenität und Staatssicherheit von der französischen Republik in Konzentrationslager gesperrt wurden.
Bevölkerungsverschiebungen größten Ausmaßes hatte schließlich die verbrecherische Politik der „Volksdeutschen Identität“ zur Folge, wie sie die Faschisten von 1933 bis 1945 praktizierten,“ gipfelnd in den Nürnberger Rassengesetzen von 1935 und der Annexionspolitik in Europa seit 1938. Es kann keinen ernsthaften Zweifel an der Schlußfolgerung von Noiriel geben, daß der im 20. Jahrhundert mit der weltweiten Durchsetzung des nationalistischen Prinzips aufbrechende Widerspruch zwischen den Menschenrechten und den völkisch-nationalistischen
Gerard Noiriel. Die Tyrannei des Nationalen. Sozialgeschichte des Asylrechts in Europa. Aus dem Franz. von Jutta Lossos und Rolf Johannes. Zu Klampen Verlag. Lüneburg 1994. 313 S., geb., 68 DM.
Staatsbürgerrechten zur gegenwärtigen Krise des Asylrechts geführt hat.
Die Genfer Konvention von 1951, die den Versuch einer internationalen rechtlichen Kodifizierung des Flüchtlingsstatus darstellte, geriet so zunehmend in Gefahr, durch die Dominanz der nationalen Machtinteressen in Frage gestellt zu werden. Auch nach dem Ende des „Kalten Krieges“ und dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ wurde nicht mit dem Bau eines „europäischen Hauses“ begonnen. Neben dem erneuten Ausbruch eines völkischen Nationalismus mit blutigen machtpolitischen Nationalitätenkriegen in ehemaligen sozialistischen Staaten wird vielmehr ein „europäischer Nationalismus“ etabliert, der sich gleichfalls über das Menschenrechtsprinzip hinwegsetzt, und zwar unter dem scheinheiligen Motto, die Werte der „Demokratie“ zu verteidigen. Als fundamental hat sich dabei das „Schengener Abkommen“ erwiesen, die er-
ste Übereinkunft für die Anwendung des Prinzips eines freien Personenverkehrs im Europa von 1993. Mit ihm wurde eine „europäische Nationalität“ eingeführt, die auf der Ausgrenzung und Abweisung von Flüchtlingen basiert. Damit korrespondieren inzwischen ideologische Aktivitäten von Historikern, ein „europäisches Bewußtsein“ zu konstruieren, das angeblich vor den Nationen existiert habe.
Der Weg zur Ausbildung eines konservativ-machtpolitischen „westeuropäischen Nationalismus“ mit Weltherrschaftsansprüchen ist beschritten. Eine bemerkenswerte Bestätigung findet die Analyse von Noiriel mit dem von Schäuble proklamierten Neuordnungsprojekt eines “Kerneuropas“, das mit Hilfe Frankreichs die ökonomische und politische Vormachtstellung Deutschlandssichern soll. Ergänzt wird dieses CDU/CSU-Projekt durch das offenkundige Bestreben, diesem „Kerneuropa“ - nach dem Vorbild des „Hinterhofs“ der USA - eine Zone von vasallentreuen Anrainerstaaten vorzulagern.
Fazit des Autors: Das Asylrecht steht heute am Scheideweg. Da der nationale Nihilismus keine Alternative zum völkisch nationalistischen Entweder-Oder-Denken ist, sondern nur seine negative Verkeh-
rung, wäre eine Bestimmung des Asylrechts zu entwickeln, „die nicht auf einer schlichten
Verneinung des Nationalen beruht, sondern auf seiner Überwindung“ So gesehen, ist dieses Buch ein Grundlagenwerk, ein wichtiger Beitrag aus französischer Sicht zum Nachdenken über die aktuelle Krise des Asylrechts in seinen historischen, sozialen und politischen Dimensionen, mit der eindeutigen Warnung vor der „Tyrannei des Nationalen“ und damit zugleich vor der sich inzwischen entfaltenden modifizierten Tyrannei eines „europäischen Nationalismus“ - ohne den Anspruch, einen praktisch politischen Ausweg zu eröffnen.
WINFRIED SCHRÖDER
„REKLAME REPUBLIK -Seltsame Berichte zur Lage der vierten Gewalt“ unterbreitet Cordt Schnibben, Reporter beim SPIEGEL, bei Rasch und Röhring. Anläßlich des Aufkommens neuer „Nachrichtenmagazine“ wie Focus und Tango beschreibt Schnibben, wie Journalismus der Werbung immer ähnlicher wird. Selbstverständlich ist das Ganze auch eine Verteidigungsschrift für Augsteins Blatt, aber nicht nur. Schnibben: „Jeder Journalist lernt im Volontariat, daß Nachrichten Meinungen transportieren. .Agitation durch Tatsachen' hieß das in der Journalistenausbildung der DDR“ (329 S., Br.,36DM).
Mit Zeitung zu tun hat auch ein Band, den der Dietz Verlag Berlin präsentiert: „Zeugen der Zeitgeschichte“ versammelt 13 Gespräche, die in der gleichnamigen Serie von Neues Deutschland erschienen sind. Die Herausgeber Holger Becker und Volker Külow sowie ihre Kollegen Karlen Vesper und Steffen Schmidt interviewten Wissenschaftler, Künstler und Publizisten, die sich an den Kämpfen dieses Jahrhunderts auf ?verschiedenen Flügeln der sozialistischen Bewegung beteiligten. Zu Wort kommen u.a. der Logiker und Schriftsteller Alexander Sinowjew, die Historiker Helmut Hirsch und Walter Markov, der Maler Robert Liebknecht, die Fotografin Gisele Freund, der Publizist Erich Kuby, der Bakunin-Herausgeber Arthur Lehning und der Finanzexperte Günter Reimann 191 S., Abb., br., 24,80 DM).
Nach dem hochpolitischen, weil eingreifenden Buch „Serbien muß Sterbien“ legt Herausgeber Klaus Bittermann in seinem Verlag Edition TIA-MAT gleich eine weitere Aufsatzsammlung unter dem Titel „Identität und Wahn“ vor. Ihr kann man die nützliche Erkenntnis entnehmen, daß Leute, die ständig und laut ?über'dief eigene Idfetttitätte*“ v ; den, gewöhnlich zu jener Spezies gehören, die letztlich alles mitmacht. Gut formulierte Gedanken zum Thema unterbreiten u.a. Robert Kurz, Peter Schneider, Roger Willemsen, Gerhard Henschel, Eckhard Henscheid, Michael Rudolf, Wiglaf Droste und Mathias Wedel (175 S.. br., 26 DM).
Österreich dürfte das Land sein, in dem sich am klarsten abzeichnet, daß die eigentliche Gefahr in den 90er Jahren nicht von braunbehemdeten „Operettennazis“ ausgeht, sondern von Rechtspopulisten in feinstem Zwirn. Unbedingte Beachtung verdient deshalb das Buch „Die Ordnung, die sie meinen - .Neue Rechte' in Österreich“, das Wolfgang Purtscheller im PICUS VER-LAG WIEN herausgab. Die Autoren analysieren die Theorien der „Neuen Rechten“ und beschreiben die „Denkfabriken“ des Jörg Haider, die ein weitverzweigtes Netz von völkischen Bildungswerken, Diskussionszirkeln, Forschungsstellen, Redaktionen usw. bilden. Und sie zeigen, wie rechtsklerikale, „nationale“ und ökologisch-spirituelle Kreise zum Schulter Schluß finden (216 S., geb., 29.80 DM).
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.