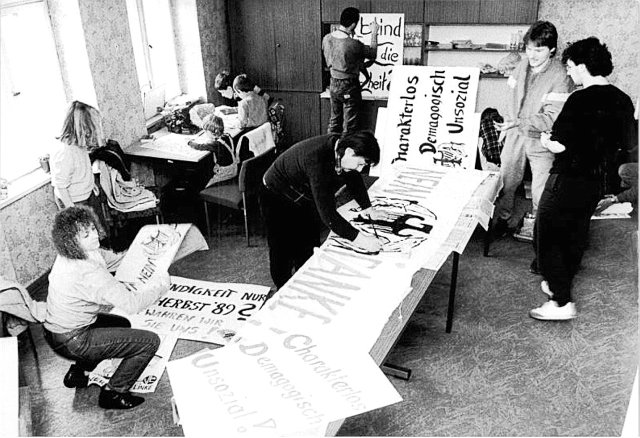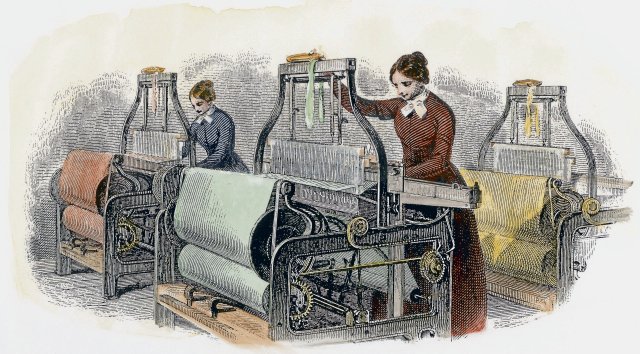- Kultur
- WIEDERgelesen
»Was hätte dem Mozart ... sein Genie genützt?«
Eine Liebende im Krieg: Arnold Zweigs großartiger Roman »Junge Frau von 1914«
Dieses Datum: August 1914 als Beginn des ERSTEN weltumspannend-mörderischen Krieges. Ein ungeheures Menetekel: Die Medien, nicht nur die deutschen, auch die französischen, englischen, amerikanischen, russischen, richten seit Monaten den Blick darauf. Es gibt lang vorbereitete wissenschaftliche Abhandlungen, detaillierte Einzelanalysen, neu gefundene Zeitzeugen-Berichte ... Was ermutigen sollte, auch wieder einmal zu jenen großen Werken der Weltliteratur zu greifen, die direkt unter dem Eindruck des Krieges entstanden sind.
»Der große Krieg der weißen Männer« - Zyklus von vier Romanen Arnold Zweigs, Lion Feuchtwanger hat ihn eine »Enzyklopädie« dieses Krieges genannt. Eine alle Aspekte des Geschehens umfassende Darstellung: »Der Streit um den Sergeanten Grischa« (1928), »Junge Frau von 1914« (1931), »Erziehung vor Verdun« (1935), »Einsetzung eines Königs« (1937). Übergreifendes Motiv ist die Erziehung und Wandlung von Menschen durch eine sich entfaltende Katastrophe.
»Der Streit um den Sergeanten Grischa« hatte Arnold Zweig weltberühmt gemacht. »Junge Frau von 1914« griff in der Chronologie zurück, in die Jahre 1914 bis 1916. Es ist, wie der Autor es nannte, ein »Roman der Liebe«. Im Mittelpunkt Lenore Wahl, dreiundzwanzigjährige Kunststudentin, Tochter eines jüdischen, wohlhabend-einflussreichen Bankiers. Sie liebt den hoffnungsvollen, allein bettelarmen Schriftsteller Werner Bertin. Für die Eltern natürlich keine Partie.
Als der Krieg ausbrach, ereignete sich das heute Unvorstellbare: Er wurde als Erlösung empfunden. Erlösung aus ausweglos stagnierenden Verhältnissen. So dies- und jenseits des Rheins, so in der brüchigen k.u.k.-Monarchie, so von begeisterten Millionen einfacher Menschen in ganz Europa und: von der überwältigenden Mehrheit der Geistesschaffenden, der Schriftsteller, Philosophen, Publizisten. Werner Bertin, in vielem ein Abbild Arnold Zweigs, gehörte zu ihnen: »Jetzt rief ihn Deutschland ... die Heimat, die Gesittung, alle seelischen Mächte, alle guten Geister des Vaterlands ...« Der Gestellungsbefehl beorderte ihn in ein Armierungs-Bataillon nach Küstrin, machte ihn zum simplen »Schipper«. Später wird die tief verletzte Lenore Wahl die bittere Einsicht aussprechen: »Was hätte dem Mozart, lebte er heute, sein Genie genützt? Sie hätten ihn ›einrückend‹ gemacht, wie der herrliche Ausdruck der Österreicher lautete, und glatt hingelegt bei Grodek wie den Dichter Trakl.«
Eigentlich hätte sie gewarnt sein müssen, als sie den geliebten Mann besuchte. Hatte ihre Freundin doch, aus eigener Erfahrung, von der bestürzenden Veränderung der Männer gesprochen, ihrem Wesensabfall in der kurzen Zeit ihres Soldat-Seins. Und so geschah ihr »diese grobe Rohheit ... in Schreck und Scham«, dass er sie nach schönem Spaziergang durch bewaldete Natur, gelagert »auf Gras und Moos«, mit Gewalt nahm.
Das Kind durfte nicht sein; die Eltern nichts davon wissen; sie musste es allein durchstehen. Sie wusste diesen Mann »durchtränkt von Schuld«, und hegte »keine Spur von Groll«. Lenore Wahl - jedem aufmerksamen Leser wird sie nun zu einer bewundernswerten Frauengestalt - gewinnt den Mut zu dem ihr aufgegebenen Weg und - was ihr Wesen reicher macht - die Fähigkeit zum Beistand. Denn, blitzte es in ihr auf, »Tausende von Soldaten trafen in diesem Augenblick viel härtere Schläge«.
Sie nimmt die leidvolle Wirklichkeit der anderen wahr und wächst über den Geliebten hinaus, der immer noch in höheren Sphären schwebt. »Das Vaterland war größerer Opfer wert ... Jetzt gingen Geist und Gewalt einig ...« Er würde »die Welt mit gebildetem Geschwätz vollpflastern«, sagt Leonore. Was sie jetzt durchlebte, in Angst, Schmerz und wilden Zornausbrüchen gegen den Abwesenden, muss jeden Leser tief betroffen machen; für damals und auch für heute.
Es ist die bedingungslos Liebende, die ihren unwissenden Eltern die Legalisierung ihrer Zukunft abnötigen wird, die Verbindung mit Bertin. Freilich haben sie gehört: »Der Mann wird berühmt« und »einen Schwiegersohn im Felde ... zur Zeit Heeresgruppe Mackensen« würde ihrem Renommee in der Öffentlichkeit guttun. Also eine Zeitungsannonce. Opportunismus in Reinkultur. Nur, die Tochter will mehr. Auf geraden und auf krummen Wegen, mit nicht nachlassender Hingabe, Hilfe suchend und erfahrend, kann sie jenes »Gesetz« des Kaiserreichs in Anspruch nehmen, das den in die Westfront Eingemauerten reklamiert: für einen »Heiratsurlaub« vier Tage. Danach wird er »seinen Platz in der Gemeinschaft« wieder aufnehmen, »die Idee ›Deutschland‹ zu verteidigen«.
Der jungen Frau bleiben am Ende Sorge und Hoffnung: »›Wenn du nur heil bleibst. Um mich kümmere dich nicht. Ich komme schon durch.‹ Zur gleichen Zeit, im selben Ton sprachen so Tausende von Frauen auf der ganzen Erde; in den Hauptsprachen der weißen Menschheit.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.