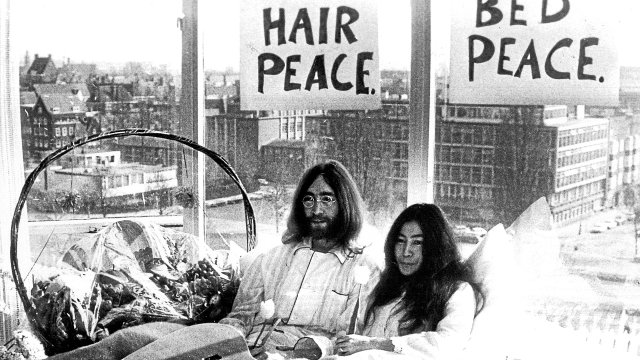Alternativen
Gelesen - bei »Z«
Im Jahr 1988 veröffentlichte das Frankfurter Institut für Marxistische Studien und Forschungen (IMSF) die »Reformalternative. Ein marxistisches Plädoyer«. Verfasser waren Heinz Jung, Leiter des IMSF, und Jörg Huffschmidt, Professor an der Universität Bremen. Beide waren Mitglieder des Parteivorstandes der DKP. Frank Deppe erinnert in Heft 107 der »Z. Zeitschrift marxistische Erneuerung« daran, dass infolge des Zusammenbruchs des Realsozialismus die Schrift rasch in einen »Strudel« geriet und schließlich in der »Versenkung« verschwand.
Die »Reformalternative« (abgekürzt: RA) hatte sich nicht nur vom dogmatischen Epochenbegriff des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus gelöst, sondern auch von der klassischen Unterscheidung von Reform und Revolution. Die Lohnabhängigen wurden darauf orientiert, ihren Kampf bei der Lösung ihrer »Tagesaufgaben« immer auch auf Reformen auszurichten, die letztendlich auf die Schaffung einer neuen gesellschaftlichen Ordnung hinausliefen. Reform und Revolution sollten verknüpft werden. Deppe wirft die Frage auf, was eine RA im Vergleich zu 1988 heute berücksichtigen muss? Die Umbrüche von 1989 bis 1991 führten zum Übergang zu einer neuen Epoche. Diese wurde charakterisiert durch den Sieg des Kapitalismus und durch die Niederlagen der kommunistischen und reformistischen Arbeiterbewegungen in Ost und West. Andererseits geriet der Kapitalismus seit 2008 in eine bis heute andauernde »multiple Krise« mit einer Zunahme von Gewalt, Terror und Krieg. Massenarmut und die Migrationsbewegungen nahmen neue Ausmaße an. Das Krisenmanagement scheiterte.
Jürgen Reusch und Jörg Goldberg vergleichen die RA mit den Reformdebatten im Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Besondere Beachtung findet dabei Dieter Kleins Terminus der »doppelten Transformation«. Mehr denn je bleibe aber unklar, wie denn jene ferne sozialistische Alternative aussehen sollte.
Mit dem bemerkenswerten Aufstieg linksdemokratischer Tendenzen (Sanders, Corbyn) in Amerika und dem Vereinigten Königreich befasst sich Ingar Solty. Er wirft die Frage auf, ob und wie die Linke sich als »dritter Pol« im Wahlsystem etablieren könne. Dieter Boris plädiert dafür, einen genaueren Blick auf mögliche Inhalte eines Linkspopulismus zu werfen. Dieser könne als Bewegung verstanden werden, die unterschiedliche Elemente subalterner Klassen zu gewinnen sucht. Siegfried Prokop
Z. Zeitschrift marxistische Erneuerung, Nr.107. 224 S., br., 10 €. Bezug: Z, Postfach 500963, Frankfurt am Main.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.