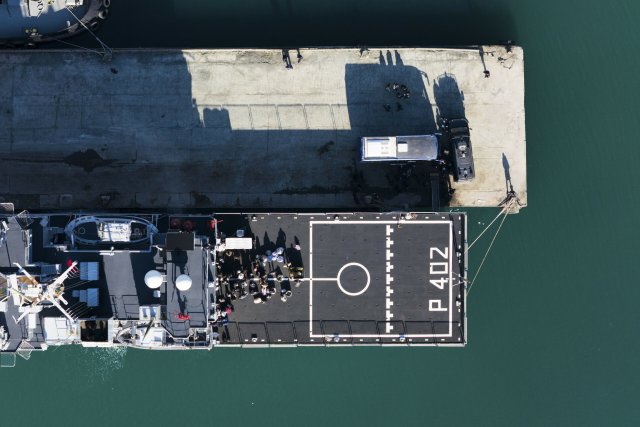- Politik
- Sicherungsverwahrung
Tiefer Eingriff in die Seele
Die Juristin Christine Graebsch kritisiert die Pre-Crime-Einsperrung: Trotz Verbesserungen nach höchstrichterlicher Rechtsprechung wirkt im Hintergrund der Strafgedanke weiter und die Schuld für mangelnde Behandlungserfolge wird den Verwahrten zugeschrieben
Im Mai 2011 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Sicherungsverwahrung für unvereinbar mit dem Grundgesetz. Mehr als elf Jahre später fragt man sich, warum es dann diese Art der zeitlich unbefristeten Unterbringung noch geben kann und warum Sicherungsverwahrung heute sogar zunehmend verhängt und vollstreckt wird.
Die Zahl der Untergebrachten mag mit knapp 600 relativ gering erscheinen. Sie macht nur gut ein Hundertstel der Strafgefangenen aus. Aber unbedeutend ist sie nicht, weil es sich um eine präventiv begründete Maßnahme handelt. Sie tritt ein, wenn die Freiheitsstrafe schon vollständig verbüßt ist. Die Untergebrachten bezeichnen sie als eine Strafe für Taten, die sie noch gar nicht begangen haben. Und man kann hinzufügen: meistens auch gar nicht begehen würden. Es stellt sich die schwierig zu erforschende Frage, ob jemand deswegen keine Straftaten begeht, weil er – oder sehr selten einmal sie – eingesperrt ist. Vielleicht würde die Person in Freiheit keine Tat begehen.
Minority-Report: Das Problem der Prognose
Das Problem wird sehr deutlich in Philip K. Dicks Kurzgeschichte »Minority Report«. Auf ihr beruht nicht nur der gleichnamige Film von Steven Spielberg, sondern auch eine ganze Reihe aktueller kriminologischer Analysen über Pre-Crime. Das ist die Tendenz, nicht erst nach, sondern schon vor einer Straftat zu intervenieren. Das klingt der Idee nach richtig. Es wäre auch richtig, wenn man sicher vorhersagen könnte, wer zukünftig sehr schwere Straftaten begehen wird. Dann könnte eine präventive Einsperrung gerechtfertigt sein. Genau diese Vorhersage war aber schon in Dicks Science Fiction aus den 1950er Jahren nicht möglich. Das wurde dem Leiter der Pre-Crime-Behörde jedoch erst bewusst, als er für sich selbst eine entsprechende Vorhersage erhielt. Er konnte dann auch selbst nicht wissen, ob er tatsächlich ein Tötungsdelikt beginge, wäre er nicht eingesperrt.
Das Problem besteht auch in der heutigen Realität. Es lässt sich aber nur selten erforschen. Eine Gelegenheit dafür ergibt sich, wenn zuvor als gefährlich deklarierte Personen entlassen werden müssen, etwa aufgrund von Verfahrensfehlern. Dann kann untersucht werden, wie viele tatsächlich die von ihnen erwarteten schweren Straftaten begehen. In solchen Studien zeigt sich grob gesprochen, dass mindestens 20 Personen eingesperrt werden müssten, um vor einer von ihnen sicher zu sein, die Straftaten begehen würde.
Der Unterschied zum Minority-Report ist, dass wir das rückwärtsgewandte Strafen nicht abgeschafft haben. Bei uns kommt die präventive Einsperrung dazu. Sie ist aber (bislang) auf diejenigen beschränkt, die meist bereits mehrere Taten begangen haben. Allerdings ist eben auch bei diesen ein Rückfall keineswegs zwingend. Außerdem werden die meisten schweren Taten von Menschen begangen, die vorher noch nie mit solchen in Erscheinung getreten sind.
Das Bundesverfassungsgericht sagt, von den auf Grundlage von Prognosen Eingesperrten würde ein »Sonderopfer« für die Gesellschaft verlangt. Ihre Unterbringung müsse daher grundlegend besser sein als die im Strafvollzug, so sieht es das sogenannte Abstandsgebot vor. Weil sie zeitlich nach Verbüßung der Strafe folgt, darf sie keinen Strafcharakter haben. Das ist einleuchtend, aber auch ein bisschen komisch. Denn gerade das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder hervorgehoben, dass auch die Art des Strafvollzugs keinen Strafcharakter haben darf. Die Strafe liegt lediglich im Entzug der Freiheit, nicht in schlechten Haftbedingungen.
Aber nun zurück zu der Frage, wie es sein kann, dass die Sicherungsverwahrung ihr Diktum vollständiger Verfassungswidrigkeit so unbeschadet überstehen konnte. Das liegt kurz gesagt daran, dass man die meisten Untergebrachten nicht entlassen wollte, auch das Bundesverfassungsgericht wollte das nicht. Um dieses Ergebnis zu erreichen, wurde eine Reihe von Argumentationsscharaden angestrengt. Sie im Einzelnen darzustellen, verbietet sich in einem nicht-juristischen Medium.
Historische Entwicklung
Es ist anerkannt, dass das Recht der Sicherungsverwahrung höchst komplex geworden ist. Gerade die Verkomplizierung der Materie gehörte aber zu den beliebten juristisch-politischen Taschenspielertricks, die – leider unter maßgeblicher Beteiligung des Bundesverfassungsgerichts – die Aufrechterhaltung der Sicherungsverwahrung ermöglichten. Dies geschah, obwohl die Widersprüchlichkeit dieser Institution damit nicht reduziert, sondern auf die Spitze getrieben wurde.
Im Wesentlichen wurde das einst für »unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher« von den Nationalsozialisten eingeführte Rechtsinstitut nunmehr zu einer Art therapeutisch motivierter Unterbringung umetikettiert. Die Sicherungsverwahrung war schon vor der NS-Machtübernahme diskutiert worden. Sie konnte nach der Schule Franz von Liszts lediglich die Funktion haben, die »Unverbesserlichen« einzusperren. Es ging also um die, die nicht als (heilbar) krank angesehen wurden. Es ging um die nicht mit Besserungsmaßnahmen wie einer Therapie Erreichbaren, die als rational bösartig betrachteten »Gewohnheitsverbrecher«. Für die Behandelbaren wurde gleichzeitig der Maßregelvollzug eingeführt. Bis heute kommen sie auch bei Schuldunfähigkeit in die forensische Psychiatrie oder in zwangsweise Suchttherapie. Es handelt sich um über 10 000 auf strafrechtlicher Grundlage eingesperrte Personen, die in der Statistik der Strafgefangenen nicht auftauchen.
Wie kam es nun dazu, die Sicherungsverwahrung plötzlich als therapeutische Unterbringung zu konzipieren? Seit Mitte der 1990er Jahre vollzog sich eine Wende in der Kriminalpolitik. Für sie stehen die offen verfassungswidrigen Worte des seinerzeitigen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (2001): »Wegschließen – und zwar für immer.« In einem rasanten Tempo aufeinanderfolgender Gesetzgebungsprozesse wurde eine Reihe an Verschärfungen des Rechts der Sicherungsverwahrung beschlossen. Sie sollten es unter anderem ermöglichen, Personen in Sicherungsverwahrung zu nehmen oder zu halten, bei denen das verurteilende Gericht dies gar nicht angeordnet hatte. Die Gesetzesänderungen gipfelten 2008 in der – noch über das NS-Recht hinausgehenden – nachträglichen Sicherungsverwahrung nach dem Jugendstrafrecht.
Man wollte diese Menschen, die bislang von ihrer Entlassung ausgehen durften, eingesperrt halten. Man maßte sich an, eine fortbestehende Gefährlichkeit nach der Entlassung aus dem Verhalten im abgeschotteten Mikrokosmos des Vollzugs ableiten zu können. Das für Strafen nach dem Grundgesetz, aber auch der Europäischen Menschenrechtskonvention geltende Rückwirkungsverbot wischte man beiseite. Es handele sich bei der Sicherungsverwahrung ja gar nicht um eine Strafe, sondern um eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Das sahen nicht nur die Betroffenen anders, die sich in nahezu exakt der gleichen Situation wie Strafgefangene fanden.
Rechtlicher Reparaturprozess
2009 bestätigte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Entscheidung »M. gegen Deutschland«, Sicherungsverwahrung sei eine Strafe. Es erfolgten aber nur wenige Entlassungen der als »tickende Zeitbomben« diskreditierten Betroffenen. Was aber folgte, war ein hektischer Reparaturprozess am Recht der Sicherungsverwahrung durch Gesetzgebung und Bundesverfassungsgericht. Was Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) als einen Dialog der nationalen und internationalen Menschenrechtssprechung feierten, wäre besser beschrieben als juristisches Ping-Pong, bei dem die Betroffenen zum Spielball wurden.
Der EGMR hatte darauf hingewiesen, dass es neben der Möglichkeit, die Freiheit wegen einer Straftat zu entziehen, noch die der Unterbringung von psychisch beeinträchtigten Personen gebe. Daraufhin kamen in Deutschland Rechtsentwicklungen in Gang, die den Umbau der (nachträglichen) Sicherungsverwahrung zu einer Art der Therapieunterbringung vollzogen. Vereinfacht gesagt machte das Bundesverfassungsgericht das Fortbestehen des Instituts der Sicherungsverwahrung von dessen – systemwidriger – Umgestaltung abhängig. Es gewährte dem deutschen Gesetzgeber eine Übergangsfrist für die aus seiner Sicht notwendige grundlegende Veränderung. Mit dieser gelang es dann, den EGMR davon zu überzeugen, dass nun kein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention mehr vorläge.
Die Entscheidung der Großen Kammer des EGMR vom 4. Dezember 2018 zeigt, dass die Richterinnen und Richter die Systemwidrigkeiten und Brüche, die Umetikettierungen und Scheinveränderungen nicht verstanden. Genauer gesagt wollten sie diese wohl nicht verstehen. Jedenfalls half es nicht, dass der portugiesische Richter Paulo Pinto de Albuquerque, der sich intensiv mit dem deutschen Recht befasst hatte und später auch ein ausführliches Sondervotum veröffentlichte, sie offenlegte.
Verpflichtende Behandlungsangebote
Trotzdem hatte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2011 auch positive Aspekte. Sie stärkte in mehrfacher Hinsicht die Rechte der Gefangenen und Untergebrachten. Insbesondere das Abstandsgebot führte zu baulich großzügigeren Unterbringungen. Auch sonst gab es diverse Verbesserungen, die man zusammenfassend als quantitative Erhöhungen der Rechte Strafgefangener bezeichnen kann. Allerdings machen diese die Sicherungsverwahrung noch lange nicht zu etwas qualitativ anderem als Strafvollzug. Auch bringen sie den Untergebrachten nicht immer reale Vorteile, wenn etwa die Mindestbesuchszeiten erhöht sind, aber längst niemand mehr geblieben ist, der zu Besuch kommen möchte. Daher bleibt als zentrale Verbesserung die des Rechtsschutzes, der in Haft ohnehin stets prekär ist.
Kernelement ist hier die zwingende Überprüfung, ob es tatsächlich erforderlich ist, die Sicherungsverwahrung weiterhin zu vollstrecken. Sie hat in relativ kurzen Abständen von einem Jahr, ab zehnjähriger Unterbringung von neun Monaten, zu erfolgen. Dabei muss das Gericht immer auch prüfen, ob der Person seitens der Anstalt ein angemessenes Behandlungsangebot zur Verfügung gestellt wurde. Dieses muss sogar schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe, die der Sicherungsverwahrung vorausgeht, überprüft werden. Die Regelung beruht auf Erfahrungen der vorangegangenen Jahrzehnte, in denen oftmals wenig unternommen wurde, was den Betroffenen hätte helfen können, einer Einstufung als nicht mehr gefährlich und damit einer Entlassung näherzukommen.
Stellt das Gericht fest, dass das Behandlungsangebot unzureichend war, muss es der Anstalt eine Frist bis zu sechs Monaten setzen, dies zu verändern. Kommt die Anstalt dem nicht nach, erfolgt danach die Entlassung – unabhängig davon, ob die untergebrachte Person weiterhin als gefährlich eingestuft wird. Diese Regelung stellte eine deutliche Stärkung der Rechte der Betroffenen dar. Sie sollten fortan nicht mehr mit Argumenten wie Personalmangel hingehalten werden können. Die Anstalt sollte nicht mehr darauf vertrauen können, dass die Untergebrachten ja ohnehin nicht entlassen würden und man sich daher Zeit lassen könnte. Auch das Argument, sie seien eben zur Behandlung nicht motiviert, sollte nicht mehr gelten. Denn das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass sie dann eben zu motivieren seien.
Kein ausreichend qualifiziertes Personal
Leider muss man heute konstatieren, dass sich diese positiven Regelungen im Ergebnis als kontraproduktiv erweisen. Oftmals verfügen die Anstalten nicht über das notwendige Behandlungsangebot, schon weil es an ausreichend qualifiziertem Personal fehlt. Auch besteht bei diesem eine hohe Fluktuation und man kann beobachten, dass gerade den Betroffenen zugewandtes Personal, mit dem diese echte therapeutische Fortschritte machen können, oft nach kurzer Zeit nicht mehr in einer Anstalt arbeiten will.
Diese Situation trifft auf eine im Vollzug verbreitete Haltung, wonach Behandlungsangebote wie eine Vergünstigung gehandhabt werden, die man sich als Insasse erst einmal verdienen muss. Im Hintergrund wirkt hier der Strafgedanke weiter. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Anstalten als Voraussetzung für alles und jedes – auch für den Zugang zu Therapieangeboten – ein Unterwerfungszeremoniell fordern. Es wird verlangt, Taten zu gestehen, Verantwortung für sie zu übernehmen, was im Urteil steht als maßgeblich für die eigene Identität anzuerkennen.
Dies geschieht auch in Behandlungsgruppen, in denen die Taten vor den anderen beschrieben werden müssen. Deren Verankerung in der Persönlichkeit und letztlich die eigene biografische Schlechtigkeit muss konstatiert werden. Solche Degradierungsrituale werden, auch entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen, als unabdingbar für einen Rückfallpräventionsplan konzipiert. Anstelle einer Orientierung an Ressourcen und den sozialen und emotionalen Potenzialen werden nur Defizite eruiert.
Die genannten prozessualen Verbesserungen bewirken hier leider das Gegenteil des Beabsichtigten. Die Anstalt möchte sich nicht nachsagen lassen, etwas versäumt zu haben, und erst recht nicht verantwortlich dafür sein, dass jemand entlassen wird. Sie setzt daher alles daran, die Schuld für mangelnde Behandlungserfolge in den betroffenen Individuen zu verankern.
Fragliche Vorwürfe gegen die Inhaftierten
Die Untergebrachten seien nicht intrinsisch zur Therapie motiviert, heißt es. Aber warum sollten sie dies für eine Zwangstherapie sein? Sie definierten sich nur als Opfer (des Justizsystems) statt als Täter. Aber warum kann man denn daran nicht therapeutisch anknüpfen? Sie formulierten keinen eigenen Therapieauftrag. Aber weshalb, wofür und woher sollten sie das können? Sie seien nicht bereit, sich (schon wieder) auf eine neue Therapeutin einzustellen, der Wechsel gehöre zum Leben. Aber warum sollte denn Therapie unter den ohnehin erheblich erschwerten Bedingungen des Vollzugs nichts mit einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu tun haben? Das hat es doch draußen auch und wäre gerade wichtig, wenn man sogar noch eine intrinsische Motivation verlangt. Und wieso sollte kein Zusammenhang mit dem jeweils therapeutischen Ansatz bestehen, den die behandelnde Person verfolgt? Es handelt sich durchwegs um Argumente, mit denen sich die Anstalt gegen Kritik abschottet und die Verantwortung auf die Betroffenen selbst schiebt.
Dies schafft eine für die Betroffenen ebenso ausweglose wie identitätsbeschädigende Lage. Sie ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass Bundesverfassungsgericht und EGMR versucht haben, mit der Fiktion von Therapierbarkeit das Institut der Sicherungsverwahrung umzufunktionieren, damit bestimmte Personen nicht entlassen werden müssen. Die dadurch entstandene Lage fügt sich in eine neoliberale Kriminalpolitik ein, die die gesellschaftlich und ökonomisch Ausgeschlossenen für ihre Situation noch selbst verantwortlich macht. Strafrechtlich begründete Einsperrung kann ihre offiziellen Zwecke (Abschreckung, Sicherung, Resozialisierung) nicht in einem Maße erreichen, das diese Einsperrung gegenüber den Betroffenen rechtfertigen könnte.
Allerdings erfüllt das Strafrecht seine unausgesprochene Funktion sehr effektiv: die Individualisierung gesellschaftlicher Probleme. Diese wirkt im präventiv begründeten Freiheitsentzug noch stärker. Sie wird dort tagtäglich durch am Individuum ansetzende Behandlungsprogramme in die Individuen eingeschrieben. Machen sie wirtschaftliche oder soziale Gründe für ihre Straftaten geltend, so wird ihnen gesagt, sie verschöben die Verantwortung auf andere. Nur wenn das Programm der Responsibilisierung absolviert ist, die Verantwortungsübernahme durch die Individuen verinnerlicht ist, kommt eine Entlassung in Betracht.
Die Therapeutisierung der Sicherungsverwahrung seit 2011 sollte dieser den Strafcharakter nehmen. Sie hat im Ergebnis aber nur eine modernisierte und wohl sogar perfidere Art der Verantwortungszuschreibung erzeugt. Sie greift in die Seele der Betroffenen eher noch tiefer ein und bringt sie zudem einer Entlassung nicht näher. Der Gesellschaft dürfte sie kaum Sicherheit verschaffen. Das Konzept der Therapeutisierung folgte schließlich auch nicht wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern juristischer Rechtfertigungsakrobatik.
Christine Graebsch ist Juristin und seit 2011 Hochschullehrerin für Rechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Dortmund. Zu ihren Schwerpunkten gehören strafrechtliche Sanktionen, Freiheitsentziehung und Straffälligenhilfe. Sie leitet das Strafvollzugsarchiv, in dem Korrespondenz mit Gefangenen geführt wird, und vertritt auch Einzelfälle vor Gericht.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.