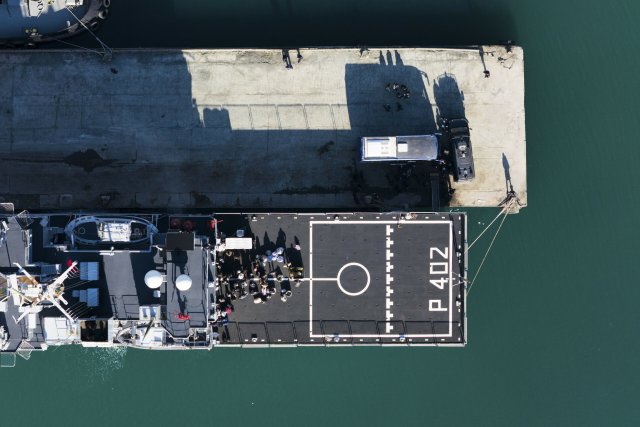- Politik
- Klimagerechtigkeitsbewegung
Klimacamp in Hannover: Veränderung beginnt im Kleinen
Das Bündnis »Ende Gelände« lädt die Klimabewegung zum System-Change-Camp nach Hannover ein

Die Schlange vor der Essensausgabe ist schon lang und zieht sich zwischen Dutzenden weißen Zelten hindurch über die große Wiese des Georgengartens in Hannover. Dabei hat das Küchenteam noch gar nicht angefangen, Mittagessen zu verteilen. »Es tut uns leid, das wird nicht die ganze Woche so! Die Küfa muss sich erst noch einspielen«, ruft eine Helferin den Wartenden zu und kündigt an, dass die anstehenden Workshops wegen der Verzögerung eine Stunde später beginnen.
Die Teilnehmer*innen des System-Change-Camps nehmen es gelassen, obwohl es schon wieder zu regnen beginnt. Eine Person liest ihren Freund*innen ein Infoheft über Anarchismus vor, die anderen hören interessiert zu. Eine andere Gruppe redet mit mir über ihre Erwartungen an das Camp, zu dem »Ende Gelände«, ein Bündnis gegen den fossilen Kapitalismus, seit Montag und noch bis Sonntag nach Hannover einlädt. Fast 1000 Klimaaktivist*innen aus ganz Deutschland sind für Workshops und Vernetzung angereist, über das Wochenende werden noch weitere Teilnehmer*innen erwartet.
Trotz des optimistischen Mottos »System Change«: »Ich möchte mir keine Illusionen machen, dass man die Welt verändern kann«, erzählt mir eine Person, die sich Brot nennt. Aus Angst vor Repressionen benutzen die meisten Camp-Teilnehmer*innen Fake-Namen. Das Camp sieht Brot eher als einen »Versuch, mit den eigenen Idealen im Einklang zu leben«. Hier könne man sich der kapitalistischen Logik entziehen: Zum Beispiel bekommen alle zu essen, ohne dafür zahlen zu müssen. Jede Person spendet, so viel sie gerade geben kann.
Tatsächlich kann das als die Keimzelle von Systemveränderungen betrachtet werden. So erklärt es die referierende Person im Workshop »How to System Change« (Wie geht ein Systemwechsel) am Dienstag: »Die Logik von Selbstorganisation ist in der Gesellschaft schon enthalten.« Auf diese Weise könne eine soziale Revolution herbeigeführt werden. Die anderen Möglichkeiten, ein System zu verändern, entweder durch schrittweise Reformen oder durch eine politische Revolution, hätten den Nachteil, dass der bestehende Staat nicht wirklich überwunden wird. Reformen bleiben systemimmanent, und ein revolutionärer Putsch erobert die Staatsmacht und nutzt sie weiter.
Soziale Bewegungen seien deswegen so interessant, weil sie diese Keimzellen der Selbstorganisation, die sonst eher aus kleinen Nachbarschaftsprojekten oder Gemeinschaftsgärten bekannt sind, vergrößern. Das Camp sei dafür ein gutes Beispiel: »Wir kochen hier zusammen, wir spülen, wir putzen Klos, obwohl wir uns gar nicht alle persönlich kennen«, heißt es im Vortrag.
Genau dafür ist Brot eigentlich ins Camp gekommen. Das umfangreiche Workshop-Programm sei ihm mental gerade zu viel. Aber er möchte sich nützlich machen und hat sich für eine Spülschicht gemeldet. Seinen Aktivismus nennt er »egoistisch«: »Ich will mich abends noch im Spiegel ansehen können.« Auch wenn ihm die Hoffnung schwerfällt, dass aus Klimacamps wie diesen langfristige Veränderungen hervorgehen – »was ist die Alternative? Konsumieren und sterben?« Als die Essensschlange endlich vorrückt und Brot an Konfettiresten im Gras vorbeikommt, hockt er sich hin und sammelt jeden einzelnen der glitzernden Plastikstreifen auf. Andere schließen sich an und helfen dabei.
Desillusioniert ist Brot von den »verlorenen Kämpfen« um den Ort Lützerath oder den Danneröder Forst, die der Braunkohle und einer Autobahn zum Opfer fielen. »Lützerath war schön und schrecklich zugleich.« Eigentlich sei es schade, dass solche Orte oder die Natur erst in Gefahr sein müssen, damit widerständige Keimzellen wie »Lützi« und »Danni« entstehen.
Die Rolle von Lützerath für die Klimagerechtigkeitsbewegung wird von verschiedenen Aktivist*innen unterschiedlich eingeordnet. Einig sind sich die meisten darin, dass die Abbaggerung des Dorfes, das die Bewegung jahrelang zu retten versuchte, einen gravierenden Einschnitt darstellt. Lützerath habe zwei Dinge deutlich gezeigt: »dass Klimaschutz in Deutschland nicht stattfindet«, aber auch, »dass der Großteil der Bevölkerung hinter uns steht«, erklärt mir die »Ende Gelände«-Sprecherin Rita Tesch.
Johanna Inkermann dagegen, die bei »Lützi lebt« und »Dept for Climate« aktiv ist, meint: »Wir verlieren den Kampf.« Der kleine rheinländische Ort habe ihr viel bedeutet. Auch jetzt hat die 34-jährige Aktivistin einen Jutebeutel bei sich, der mit dem großen gelben X versehen ist, dem Symbol des Widerstands in Lützerath. Am Rande des Klimacamps versucht sie, den Widerspruch in Worte zu fassen, der mit der Räumung des besetzten Ortes im Januar deutlich wurde: »35 000 Menschen kamen bei Shitwetter in diesen schlecht angebundenen Ort. Es war ein krasser Bewegungsmoment: Alle haben sich unter dem gelben X versammelt.«
Tatsächlich ist aus strategischer Perspektive vieles gelungen, was sonst zum Teil weniger gut funktioniert. Die Bewegung wirkte stark und geeint. Bürgerliche und radikale Gruppierungen arbeiteten Hand in Hand. Die Medienresonanz war überwiegend positiv. Und trotzdem konnte der Ort nicht gerettet werden. »Viele kämpfen noch immer damit«, sagt Inkermann. Für sie steht jedoch fest: »Aufgeben ist keine Option. So weit bin ich noch nicht.«
Deshalb hat sie mit Menschen aus verschiedenen Klimagruppen eine Strategiekonferenz organisiert, die in die ersten drei Camptage integriert ist. Natürlich sei die Frage, ob eine richtige Strategie überhaupt möglich ist. »Eine Bewegung bewegt sich ja«, sagt Inkermann lachend. Konkret sollten aber Wege gefunden werden, wie unterschiedliche Teile der Bewegung dauerhaft zusammenarbeiten können.
Zum Beispiel habe es einen produktiven Austausch zwischen Aktivist*innen der »Letzten Generation« und von »Wir fahren zusammen« gegeben. Letztere Gruppe bemüht sich um eine Zusammenarbeit mit Arbeiter*innen und sieht diese Kooperationen durch den Aktivismus der »Letzten Generation« gefährdet. »Miteinander reden statt übereinander ist sehr wertvoll«, bilanziert Inkermann am Ende der Konferenz.
Die Vernetzung mit Arbeitskämpfen sowie solchen um kostenlosen Nahverkehr oder vergesellschafteten Wohnraum wird im »How to System Change«-Workshop ebenfalls als guter Ansatz genannt, um eine Bewegung in den Alltag der Menschen zu integrieren. Das Leben im Camp oder in einer Besetzung sei sehr davon getrennt, der Alltag bleibe im kapitalistischen System verankert. Deshalb müsse man dorthin gehen, wo Menschen arbeiten und wohnen. Wie das gehen kann, wird in verschiedenen anderen Workshops überlegt. Das langfristige Ziel sei »eine massenhafte Aneignung der Mittel, um herzustellen, was wir zum Leben brauchen«, erklärt die Person, die den Vortrag hält.
So utopisch eine solche soziale Revolution in absehbarer Zeit ist und so weit entfernt die gelebte Utopie im Camp vom Alltag der meisten Menschen scheint, so alltäglich sind viele Dinge, die auch für das System-Change-Camp wichtig sind: von der Küfa (Küche für Alle) über Wasseranschluss und Dixi-Toiletten – um ökologischere Kompostklos zu mieten oder zu bauen fehlten Geld und Kapazitäten – bis hin zur erneuerbaren Energie. Die zehn Workshop-Zelte, die sich über das Camp erstrecken, sind alle mit Strom ausgestattet, viele Referent*innen benutzen Beamer, teilweise wird auch Technik für Simultanübersetzung verwendet.
Sämtliche Stromkabel, die zu den Zelten verlegt sind, münden in einem weißen Anhänger am Rande des Camps. Auf der anderen Seite ist dieser mit mehreren Solarzellen verbunden, die auf der Wiese verteilt sind. Maximal sechs Kilowattstunden Strom können damit erzeugt werden, sagt Herbert vom Strom-Team des Camps zu »nd«. An einigen Tagen ist es allerdings zu trüb und regnerisch für Sonnenenergie. Für diesen Fall gibt es einen Akku mit einer Kapazität von 30 Kilowattstunden Energie und im Zweifel auch noch zwei Benzingeneratoren, die bei einem Wolkenbruch am Mittwochabend angeworfen werden mussten. »Der soll aber so wenig wie möglich zum Einsatz kommen«, betont Herbert.
Besonders viel Energie werde für Programmzelte, Küche und Konzerte am Abend benötigt. Aber mit dem Wagen – Herbert öffnet die Tür zum Anhänger, der von oben bis unten mit Kabeln und Technik vollgestopft ist – »läuft alles«, ist er überzeugt. Am Donnerstag gibt er einen Workshop, in dem er anderen beibringt, wie sie sich eine eigene Balkonsolaranlage bauen können. »Das ist eine Möglichkeit, die Energiewende in die eigene Hand zu nehmen.« Und deutlich leichter umzusetzen als Workshop-Einheiten über Alternativen zum Kapitalismus.

Herbert sagt, er habe noch Hoffnung auf Veränderung. Lützerath habe ihm gezeigt, dass die Klimabewegung präsent ist, und auch die vielen Menschen im Camp bestärken ihn. Da von dieser Campwoche, anders als von früheren, keine Massenaktion zivilen Ungehorsams ausgeht, »hatte ich Sorge, dass wir nicht so viele werden« – zu Unrecht, wie sich herausstellt. Aber er sagt auch: »Wir brauchen wieder ’nen Bagger!« Und meint: einen Ort, zu dem Massen mobilisiert werden, um ein starkes Bild gegen den fossilen Kapitalismus zu erzeugen, wie es bei früheren Besetzungen von Kohlegruben der Fall war.
Inzwischen steht vor allem die Gasindustrie im Fokus der Kämpfe. Die nächste Massenaktion zivilen Ungehorsams plant »Ende Gelände« daher Ende September auf Rügen, wo die Bundesregierung ein neues LNG-Terminal für klimaschädliches Flüssiggas plant.
Ein utopischer Ort ist das System-Change-Camp aber nicht für alle Menschen, genauer gesagt: Es ist nicht automatisch ein sicherer Ort. »Auch als linke Gruppe sind wir nicht frei von Sexismus und Rassismus, da wir das von klein auf gelernt haben«, erklärt mir Schnecke. Sie kümmert sich um Awareness im Camp, also um Achtsamkeit und besonders um die Menschen, die diskriminierendes Verhalten erlebt haben. Leider komme es bei Klimacamps immer wieder zu sexualisierter Gewalt oder Mikroaggressionen, worunter sie »mackerhaftes Verhalten« versteht oder, dass BIPoCs (Schwarze, Indigene und nicht-weiße Menschen) von anderen angestarrt werden.
Deshalb gibt es hinter dem Awareness-Zelt auch einen Safer Space für BIPoCs – obwohl oder gerade weil kaum BIPoCs da sind. Zwei von ihnen, Say und Abdoui, sagen, sie würden sich daher auch nicht besonders wohl fühlen. Wenn sie in einem Workshop die einzige nicht-weiße Person sei, falle es ihr schwer, sich mit den anderen zu verbinden, sagt Say. Obwohl im Camp-Aufruf der Zusammenhang von Klimakrise, Kolonialismus, Ausbeutung des globalen Südens und Rassismus hervorgehoben wird und sich einige Workshops um diese Themen drehen, fehlen BIPoC-Aktivist*innen.
»Ich hätte erwartet, zumindest im internationalen Zelt welche zu finden. Aber selbst dort sind vor allem weiße internationale Gruppen«, sagt Say. Eigentlich gebe es BIPoC-Gruppen in Hannover, weiß Abdoui und kritisiert, dass Ende Gelände mit diesen offenbar nicht richtig zusammenarbeite. Abdoui gebe selbst Workshops zu kritischem Weißsein, und stelle immer wieder fest, dass weiße Aktivist*innen zwar gewillt sind, zu lernen, aber das Gelernte nicht umsetzen können.
Ozan, ein Aktivist aus der Türkei, findet, es helfe auch nur bedingt, das Problem in Awareness-Strukturen auszulagern und PoC dafür zu instrumentalisieren, weiße Menschen weiterzubilden. »Alle müssen es mitdenken«, ergänzt Abdoui. Die deutsche Linke sei noch immer zu individualistisch und zu wenig solidarisch, meint Ozan. Abdoui ist jedoch wichtig zu betonen, dass sich schon vieles verbessert hat. »Vor fünf Jahren wusste die Bewegung noch gar nichts von Mikroaggressionen«, sagt sie. »Da gibt es schon eine gute Entwicklung.«
Schnecke sieht ein weiteres Problem darin, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung insgesamt aus überwiegend privilegierten Menschen mit akademischem Hintergrund besteht. Aktivismus kostet Zeit und Geld, viele der Workshops erfordern einen gewissen Bildungsstand, der mit einer Machtposition einhergeht. Gerade der Zeitfaktor hat außerdem zur Folge, dass Aktivist*innen ausbrennen. »Mir fällt das bei mir selbst auf«, sagt Schnecke. »Entweder ich übernehme mich total oder ich brauche eine Aktivismus-Pause.« Auch dafür sei Awareness wichtig. Zahlreiche Workshops drehen sich deshalb um achtsamen und nachhaltigen Aktivismus.
Aktivismus bedeute letztendlich, »sich immer wieder selbst zu reflektieren«, sagt eine Aktivistin, die sich Belgrad nennt, mit der ich vor dem Regen in ein leeres Zelt geflüchtet bin. Sie ist in »Tümpeltown« aktiv, einem besetzten Waldstück in der Hannoveraner Leinemasch. Die Besetzung richtet sich gegen einen Straßenausbau, außerdem gehe es aber – genau wie im Camp – darum, »weg zu sein vom System«. Für sie seien solche Orte auch als queerer Freiraum wichtig, da Belgrad andere Pronomen verwendet, als man ihr im Alltag zuschreibt. »Natürlich ist es eine Illusion, dass morgen eine anarchistische Weltrevolution kommt. Veränderung beginnt im Kleinen und muss erprobt werden«, sagt sie.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.