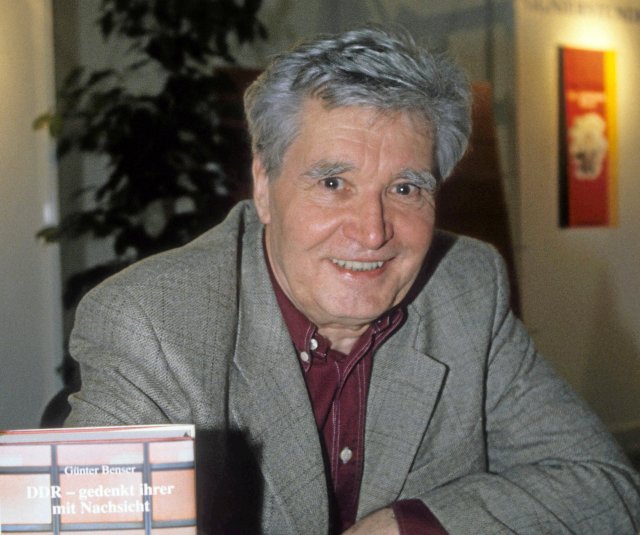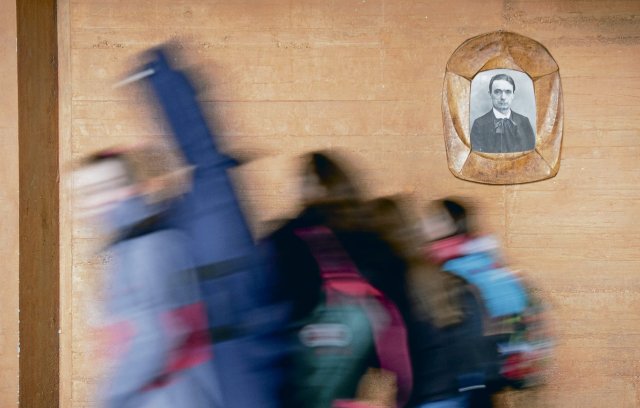- Kultur
- Max Frisch
Das verpasste Deutschland
Vor 70 Jahren erschien »Stiller« – der Schweizer Max Frisch zeigte, wozu deutsche Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr fähig war

Nein, er mochte seine Landsleute nicht. Schweizer, das waren für ihn geschäftstüchtige Opportunisten und moralische Heuchler. Menschen, die mit den Nazis Geschäfte gemacht hatten und nach 1945 behaupteten, sie wären schon immer Antifaschisten gewesen. Doch Bücher sind oft klüger als ihre Verfasser. Zwischen den Zeilen geben sie Dinge preis, die die Glaubwürdigkeit des Autors und damit seine Urteile und Meinungen untergraben.
Was natürlich perfekt zu »Stiller« passt, einem Roman, in dem die Glaubwürdigkeit von Anfang an infrage gestellt wird. Ein Ich-Erzähler, der behauptet, nicht der zu sein, für den ihn alle halten. »Ich bin nicht Stiller!«, so beginnt Max Frischs Debütroman, der bei seinem Erscheinen 1954 zum Bestseller avancierte. Der Rest ist Literaturgeschichte. Die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten über Frischs Spiel mit der Identität – wer ist man eigentlich, und kann es gelingen, sich neu zu erfinden? – dürfte in die Hunderte, ja, Tausende gehen. Längst ist das Buch in den Kanon der Weltliteratur eingegangen und hat das Schicksal aller Klassiker erlitten: Es ist totinterpretiert. Sekundärliteratur killed the living book.
Da hilft nur, es mit Jacques Derrida zu halten: Man muss das Buch dekonstruieren. Es gegen den Strich lesen. Als wäre es nie veröffentlicht worden. Als hätte man es 70 Jahre nach seiner Entstehung in irgendeinem Nachlass gefunden. Und so tun, als wären einem dieser Max Frisch und all die Dinge, die man im Deutschunterricht über ihn und sein Werk erfuhr, komplett fremd. Amnesie als Chance.
Und dann staunt man erst mal. Der Wahn der Nazidiktatur, der Zweite Weltkrieg und die systematische Ermordung von Juden – all das hat natürlich die deutsche und österreichische Literatur nach 1945 geprägt. Umso mehr als im öffentlichen Leben eine kollektive Verdrängung einsetzte. In der BRD und in Österreich gab es plötzlich nur noch Menschen, die gegen ihren Willen »Heil Hitler!« gerufen hatten. Aber auch in Ostdeutschland fand eine Aufarbeitung nicht statt. Bereits 1946 erlaubte die SED ehemaligen NSDAP-Mitgliedern den Eintritt in die Partei. 1949 wurde die neu gegründete DDR offiziell nazifrei. Faschisten gab es fortan nur noch im Westen. Geflissentlich überging man, dass mehr als ein Viertel der SED-Mitglieder lediglich das braune gegen das rote Parteibuch eingetauscht hatte (wie eine interne Untersuchung 1954 ergab) und dass die Blockpartei NDPD bewusst als Auffangbecken für Altnazis diente.
So waren es hüben wie drüben die Literaten, die sich mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzten. Ob Anna Seghers oder Hermann Kant, ob Heinrich Böll oder Günter Grass, die Nazizeit war in ihren Büchern – selbst dann, wenn sie nicht explizit darüber schrieben – immer präsent. Der Berg an Schuld, den man in gerade mal zwölf Jahren angehäuft hatte, gebar eine bleischwere Literatur, die in sich abgekapselt war. Man beschäftigte sich mit sich selbst; schließlich gab es mehr als genug aufzuarbeiten. Was aber jenseits von Österreich und den beiden Deutschlands geschah, erfuhr man, wenn überhaupt, nur am Rande.
Schon deshalb ist »Stiller« eine Wohltat. Der Roman öffnet sich – im wörtlichen Sinn – der Welt. Die Protagonisten zieht es nach »Neuyork«, nach Paris, nach Toledo, nach Mexiko. In einer Zeit, in der die Deutschen bestenfalls per Bummelzug an die Ostsee oder in den Schwarzwald reisten, um dort ihren Jahresurlaub zu verbringen, fliegen Max Frischs Akteure wie selbstverständlich nach Ägypten. Sie sind Kosmopoliten, lange bevor der Massentourismus die Idee dahinter pervertierte.
Doch die Modernität hört bei den Reisezielen und Verkehrsmitteln nicht auf. Eine Scheidung zieht im Zürich der frühen 50er – anders als in der kleinbürgerlichen Bundesrepublik – nicht die gesellschaftliche Ächtung nach sich, sondern gilt als akzeptable Option für zerrüttete Ehen. Auch sind Abtreibungen in der Schweiz bei medizinischer Indikation straffrei. Den Interpretationsspielraum, der sich dadurch auftut, nutzen liberalere Kantone und Ärzte. Daher geht eine Abtreibung in »Stiller« ohne viel Aufhebens über die Bühne. Es geschieht, weil die Frau es so will. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Überhaupt die Frauen. Während die westdeutschen Patriarchen bis 1958 ermächtigt waren, mit der Eheschließung die Arbeitsstelle ihrer Angetrauten zu kündigen (was viele prompt auch taten), nimmt sich eine Schweizer Gattin das Recht heraus, nach New York zu fliegen und dort zwei Jahre lang zu arbeiten. Das Außergewöhnliche daran ist die Selbstverständlichkeit, mit der Max Frisch solche Akte der Selbstbestimmung beschreibt. Ein Paar beschließt die offene Ehe – so what! Immer wieder muss man sich beim Lesen vergewissern, dass dieses Buch tatsächlich 1954 erschien, ja, dass Max Frisch Ideen hierfür bereits Ende der 40er Jahre hatte. Dass ausgerechnet die Schweiz Inbegriff von Progressivität ist, hätte man nicht erwartet.
Und doch ist es plausibel. Man vergisst heute allzu leicht, dass das Dritte Reich kein zwölfjähriges Intermezzo war, sondern ein Einschnitt, der Deutschland und Österreich bewusstseinsmäßig um Jahrzehnte zurückwarf. Freie Denk- und Lebensweisen, die in der Weimarer Republik nicht nur in der Boheme, sondern auch in Teilen des Bürgertums Anhänger gefunden hatten, wurden mit der Machtübernahme der Nazis 1933 zermalmt. Es gab nach 1945 keine Intelligenzija, keine Künstlerschaft mehr, die diesen Namen verdient hätte. Deutschlands Kulturleben war emigriert. Verschwunden.
Im Deutschland der Nachkriegsjahre suchte man jüdische Filmemacher wie Billy Wilder und jüdische Autoren wie Kurt Tucholsky vergebens. Stattdessen kaperten die einstigen Wehrmachtssoldaten den Kulturbetrieb. Dahin war die Leichtigkeit von Filmen wie »Menschen am Sonntag« und von Erzählungen wie »Schloss Gripsholm«. Und das sollte lange so bleiben. Die gekappte Verbindung zu den kulturell wilden Zwanzigern und frühen Dreißigern war in Deutschland bis in die 80er Jahre hinein zu spüren. Maxim Biller war der erste jüdische Autor, der es schaffte, den 1933 abgeschnittenen geistigen Faden wieder aufzunehmen und weiterzuspinnen.
Anders in der Schweiz. Hier gab es keinen Kulturbruch, keine Stunde Null. Denn die Eidgenossen hatten mit den Nazis zwar Geschäfte gemacht, aber sie hatten keinen Weltkrieg angezettelt und keine Juden vergast. Ihre Schuld war, verglichen mit der deutschen, ein Ameisenhaufen. Und das muss auch Max Frisch so empfunden haben. Sein literarisches Ich mag noch sehr über die Landsleute schimpfen – es bleibt eine oberflächliche Empörung. Eine rhetorische Pflichtübung, um sich danach wieder der großen weiten Welt zu widmen.
Doch es ist nicht nur der Horizont, der »Stiller« von den in jener Zeit erschienenen deutschen Romanen (wie Heinrich Bölls »Haus ohne Hüter«) unterscheidet. Es ist der Sound und das Lebensgefühl, das sich darin ausdrückt. Ohne tonnenschwere Schuldgefühle schreibt es sich leichter. Das gilt für die Tragikomödien von Friedrich Dürrenmatt und erst recht für die Romane von Max Frisch. Die gelassene Klarheit, mit der Letzterer die Irrungen und Wirrungen seiner Protagonisten beschreibt, üben einen unwiderstehlichen Sog aus – wie ein Roadmovie, das zwischen diversen Abenteuern tiefenentspannt vor sich hintuckert. So relaxt wie Max Frisch schreiben sonst nur die Amis.
Und mit einem Mal begreift man das ganze Ausmaß der geistig-kulturellen Verwüstung, die der Faschismus in Deutschland und Österreich angerichtet hat. All die verquasten und verschwurbelten Bücher, die in den Jahren und Jahrzehnten nach dem Krieg vom Literaturbetrieb hochgeschwemmt wurden, waren das Produkt von Menschen, die mit sich selber nicht im Reinen waren. Die nicht die innere Freiheit besaßen, sich auf die Gegenwart einzulassen, weil die Verbrechen ihrer Väter sie immer wieder in die Vergangenheit zurückrissen. Deutsche hatten der Welt den Krieg erklärt. Aus diesem Bewusstsein heraus war es unmöglich, weltoffene Romane zu schreiben.
Das musste der Schweizer Max Frisch stellvertretend für Deutsche und Österreicher erledigen. Daher ist die Freude an »Stiller«, diesem unfassbar jung gebliebenen Roman, eine getrübte. Immer wieder kommt beim Lesen der Gedanke hoch: »Verdammt, so hätte die deutsche Literatur nach 1945 sein können – mondän, inspirierend, aufregend!« Aber auch das hat Hitler zunichtegemacht.
Max Frisch: Stiller. Suhrkamp, 448 S., br., 12 €.
Längst ist das Buch in den Kanon der Weltliteratur eingegangen und hat das Schicksal aller Klassiker erlitten: Es ist totinterpretiert. Sekundärliteratur killed the living book.
-
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.