- Wissen
- Kulturtheorie
Fredric Jameson: »Immer historisieren!«
Über die Bedeutung des Werks, das der kürzlich verstorbene Kulturtheoretiker Fredric Jameson hinterlässt
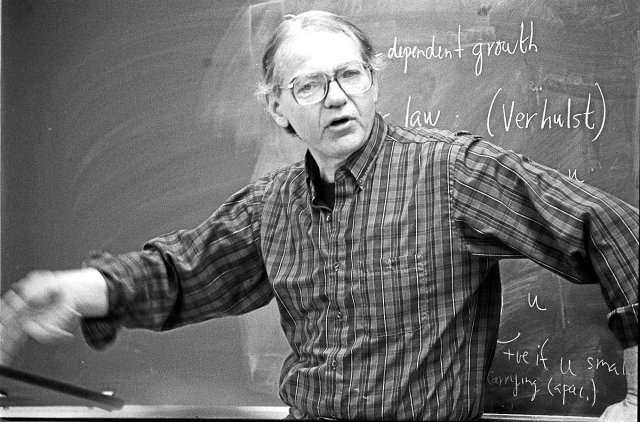
Viele deutsche Philosoph*innen und Theoretiker*innen des 20. Jahrhunderts – von Martin Heidegger über die Frankfurter Schule bis Walter Benjamin – werden im Ausland intensiv gelesen. Im französisch-, englisch- und sogar spanischsprachigen Raum gibt es ganze Schulen, die sich auf sie aufbauten. Andersherum aber werden diese Lesarten oft wenig wahrgenommen. Man kennt vielleicht manch großen Namen aus der Theorie, aber nur wenige werden systematisch rezipiert. Besonders deutlich wird dies an dem amerikanischen Kulturtheoretiker Fredric Jameson, der am 22. September 2024 im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Zahlreiche Nachrufe würdigten den »großen Literaturkritiker, Theoretiker und Marxisten« (»Zeit«), einen »der einflussreichsten marxistischen Kritiker und Literaturtheoretiker« (»Taz«) oder den »Ausnahmetheoretiker« (»WOZ«), der aber »in Deutschland zeit seines Lebens merkwürdig unbekannt geblieben« (»Spiegel«) sei. Aber wofür stand Jameson?
Über die Kulturindustrie hinaus
Fredric Jameson gehört heute in Großbritannien und den USA zu den einflussreichsten Literaturwissenschaftlern. Sein Werk ist stark beeinflusst von den britischen Cultural Studies, der deutschen Kritischen Theorie und den französischen Existenzialisten und Poststrukturalisten. Trotzdem wurden nur wenige seiner Bücher ins Deutsche übersetzt, vor allem nicht sein bekanntestes Werk »Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism«. Jameson unternahm darin Mitte der 80er Jahre eine Gegenwartsdiagnose anhand verschiedener kultureller Phänomene, von Kunst über Film, Video, Literatur und Architektur bis hin zur postmodernen Theorie. Er erweiterte den Kulturindustriebegriff von Adorno und Horkheimer mit Theorien des Situationisten Guy Debord und des Simulations- und Medientheoretikers Jean Baudrillard über die zunehmende Totalisierung kapitalistischer Produktionslogik.
Der rechten Idee vom »Ende der Geschichte« hielt Jameson entgegen, dass alles nun »mehr denn je in einer einzigen Geschichte vereint« sei.
Jameson gilt deswegen oft als wichtigster Kritiker des »Postmodernismus«. Aber vor allem kontextualisierte er postmoderne Kunst und Theorie in ihren historisch-materialistischen Zusammenhängen und stellte sie in eine Kontinuität mit Prozessen, die ihren Ursprung in kulturellen Tendenzen des Modernismus hatten. Hierin liegt tatsächlich seine eigentliche Kritik des Postmodernismus, der eben selbst nicht mehr historisiere, sondern wild die ganze Kulturgeschichte kannibalisiere. Das moderne Stilmittel des Zitats werde in postmodernen Codes zu einer oberflächlichen, geschichtslosen Collage, einem »Pastiche«. Das hielt Jameson auch dem von der postmodernen Theorie ausgerufenen »Ende der großen Erzählungen« entgegen: Das Pastiche, schrieb er, werfe die Hoch- wie Populärkulturen der Welt in einem Metanarrativ des globalen Kapitalismus zusammen, das permanent nur auf sich selbst verweise. Für Jameson war das nur die logische Konsequenz aus der Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise selbst, die sich nun eben auch die Kultur unterwerfe, totaler als es noch die moderne »Kulturindustrie« konnte.
Strikt dialektisch
Begriffe wie das Pastiche, genau wie einzelne Sätze seiner Bücher (»Immer historisieren!«) werden oft zitiert. Berühmtheit auch in der deutschen Linken verschaffte ihm jener Satz, der ihm von Mark Fisher zugeschrieben wurde: »Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als ein Ende des Kapitalismus.«
Doch die eigentliche Bedeutung von Fredric Jamesons Werk liegt in seiner dialektischen Methode. Dialektik ist in Jamesons Texten eine dynamische Denkbewegung, die es erlaubt, den Gegenstand der Untersuchung in seiner historisch-materialistischen »Totalität« zu erfassen. In Hegels berühmtem Beispiel der Herr-Knecht-Dialektik ist für Jameson der Sklave »nicht das Gegenteil des Herrn, sondern zusammen mit ihm ein ebenso integraler Bestandteil des größeren Systems, das man Sklaverei oder Herrschaft nennt«. Wenn der globale Kapitalismus ein totalisierendes System ist, muss die Dialektik ihm mit einer totalen Analyse antworten.
So hielt Jameson, ausgerechnet nach dem Fall der Sowjetunion und der akademischen Delegitimierung des Marxismus, sowohl den konservativ-liberalen Jubilanten des Kapitalismus wie den linken Antimarxisten eine Analyse hoch, die den Anspruch auf utopische Möglichkeiten aufrechterhielt, auch und gerade in der Massenkultur. Der rechten – ausgerechnet unter Berufung auf Hegel formulierten – Idee vom »Ende der Geschichte« hielt Jameson entgegen, dass die vorher vielfältigen, kontingenten historischen Prozesse und mögliche Zukünfte nun »mehr denn je in einer einzigen Geschichte vereint« seien. Die postmoderne Linke stellte »Heterotopien«, »Nomadismus« oder »Différance« gegen einen vermeintlich »totalitären« marxistischen Anspruch, der eine gegebene Gesellschaft und ihre geschichtliche Formation als Ganzes zu analysieren suchte. Jameson erinnerte immer daran, dass es weiterhin gelte, »das System beim Namen zu nennen«.
Denken in der Katastrophe
Mark Fishers Satz von der Unmöglichkeit, das Ende des Kapitalismus zu denken, ist daher auch eine Verzerrung der Analyse Jamesons. Denn dieser drückte jenen Gedanken zwar öfter aus, aber meistens in abgewandelter Form, indem er nämlich an der Kraft des Utopischen festhielt: »Jemand hat einmal gesagt, es sei leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Wir können dies nun revidieren; tatsächlich sehen wir gerade den Versuch, sich den Kapitalismus vorzustellen, indem wir uns das Ende der Welt vorstellen.« Jameson stellte hier eine Beobachtung an, die direkt von Walter Benjamin stammen könnte.
Wie Benjamins Werk dreht sich auch das von Jameson um die geschichtliche Bewegung und die Möglichkeitsbedingungen utopischen Denkens in der fortschreitenden Katastrophe des Kapitalismus. Benjamin erweiterte die dialektische Methode um zwei wichtige Aspekte, die Jameson von ihm übernahm. Erstens nutzte er Benjamins Überlegungen zur Allegorie, um Vieldeutigkeit und Gleichzeitigkeit zu denken, die sich in einem gegebenen historischen Objekt – einem Text oder einem Kunstwerk – verdichten. Damit hielt Jameson dem orthodoxen Marxismus, der Dialektik nur zwischen zwei Gegensätzen denken konnte (Proletariat und Bourgeoisie, Basis und Überbau usw.), ebenso wie dem zur Beliebigkeit tendierenden liberalen Pluralismus ein Denken entgegen, welches das schlechte Ganze »beim Namen nennen« konnte, ohne die komplizierten Widerstände und Dynamiken in seinem Inneren zu unterschätzen.
Zweitens erkannte Jameson in Benjamins Messianismus das Potenzial, in der Niederlage die Utopie und Hoffnung zu denken. Benjamins berühmter »Engel der Geschichte« drückt für Jameson zwar die Erfahrung der Niederlage aus, aber nicht das Ende der Geschichte (und damit der möglichen Zukünfte). Er erinnert dazu an Kafkas Satz, es gebe Hoffnung, nur nicht für uns.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Derlei Überlegungen waren für Jameson nicht abstrakt; ihm ging es nicht um eine Geschichtsphilosophie, sondern um konkrete Arbeit am Material. Damit stand der den postmodernen Theorien bei aller Kritik doch nahe. Der gelernte Romanist, der über Sartre promoviert hatte, verfolgte aufmerksam, was in Frankreich in den 60er und 70er Jahren geschah. Wie die französischen Denker der Nachkriegszeit wollte auch Jameson nicht Philosophie, sondern Theorie betreiben und sich damit vom systemischen, abstrakten Anspruch der Philosophie befreien. Damit verbunden war auch die Hinwendung zu alltäglichen Dingen; nicht von ungefähr schrieb der marxistische Soziologe Henri Lefebvre in dieser Zeit seine »Kritik des Alltagslebens«.
Über ein Glas Bier philosophieren
In einer berühmten Anekdote sagte der französische Philosoph Raymond Aron zu Jean-Paul Sartre, in einem Pariser Café sitzend: »Das bedeutet: man kann über dieses Glas Bier philosophieren.« (Jameson – »immer historisieren!« – korrigiert: es war eigentlich ein Minzlikör). Es ging diesen Theoretikern nicht mehr um Logik oder das Sein an sich, sondern um eine umfassende Philosophie der Praxis (in Anschluss an Antonio Gramsci), die keine Disziplingrenzen kannte und Philosophen mit Soziologen, Anthropologen mit Literaturwissenschaftlern, Historiker mit Linguisten zusammenbrachte. In der deutschen Variante gipfelte das in der Frage des späteren Merve-Verlegers Peter Gente an Adorno: »Ist Theorie praktizierbar oder nicht?«
Jameson historisierte in seinem Werk auch die »Jahre der Theorie« in Frankreich, von ihren Anfängen in der Résistance über die intellektuelle Blüte der 50er und 60er Jahre, der Revolution der Universitäten durch die »68er« bis zu ihrem Niedergang im Kontext des neoliberalen Umbaus der französischen Gesellschaft unter Francois Mitterand, der auch an den Unis die Theorie wieder in die Philosophieinstitute zurückdrängte.
Man könnte Jameson selbst ebenso als Produkt dieser Epoche beschreiben, als einen ihrer »Epigonen«, wie er selbst kritisch die heute übrig gebliebenen Theoretiker nannte. Doch sein dialektischer Ansatz, der Originalität und kritische Offenheit im Umgang mit solchen Theorien mit konsequenter Rückbindung an die historisch-materialistische Methode des Marxismus vereinte, bewahrte Jamesons Denken vor der Erstarrung. Sein zwischen Kulturwissenschaft, -kritik und -theorie angesiedeltes Werk ist ebenso unverzichtbar für eine Diagnose des 20. Jahrhunderts wir für die Vorbereitung auf das, was uns im 21. noch erwartet.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







