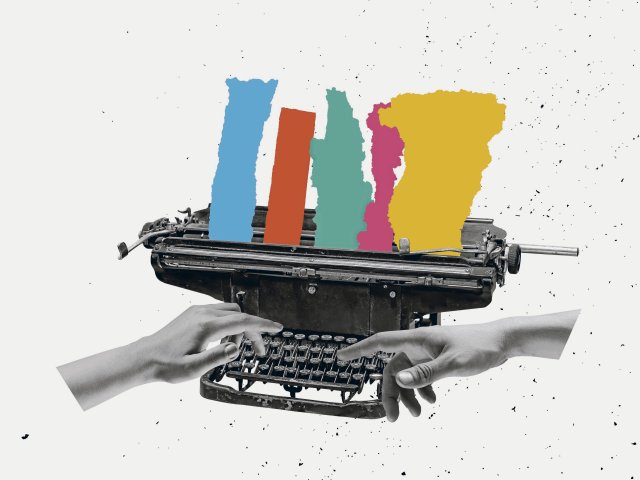- Kultur
- Klavierunterricht
Falsches Spiel
Musikunterricht in Zeiten der ausbleibenden Transformation

Alexander Estis, freischaffender Jude ohne festen Wohnsitz, schreibt in dieser Kolumne so viel Schmonzes, dass Ihnen die Pejes wachsen.

Als ich ein kleiner jüdischer Junge war, hatte ich eine postsowjetische Klavierlehrerin. Eigentlich war nur die Zeit inzwischen postsowjetisch, sie aber war noch ganz und gar eine sowjetische Klavierlehrerin: Ihre Methoden waren sowjetisch, ihre Stimme war sowjetisch, ihre Finger und ihre Hände waren sowjetisch, ihre Haut, ihre Kleider und ihre Tasche und ihr Bücherregal samt deren Inhalt und natürlich auch ihre klassische Spanplattenkommode – alles das war sowjetisch.
Allein bei den Mandarinen, die in einer Schale faulten und Fruchtfliegen anlockten, war nicht ganz klar, ob sie schon postsowjetisch oder noch sowjetisch waren. Ihr Klavier jedenfalls war sowjetisch, auf dem Klavier lag sowjetischer Staub, auf dem Staub ein sowjetisches Lineal, und mit diesem Lineal drückte sie mich auf sowjetische Weise nieder zur Tastatur, weil ich, wie sie dazu sagte, »mit dem ganzen Körper« spielen sollte.
Da ich weitsichtig war, begann die Tastatur in diesen Augenblicken zu verschwimmen – und ich sah umso weniger, je tiefer ich den Kopf halten musste. Trotzdem erkannte ich einmal, derart über die Tasten gekrümmt, wie eine Fruchtfliege zwischen E und F für immer verschwand. Seither fürchtete ich, meine sowjetische Lehrerin könnte mich so tief hinunterbeugen, dass ich in dieser verfließenden Tastatur ertrinke, in sie hineinsinke wie eine Fruchtfliege.
Immerhin freute es mich, wenn sie das Lineal nur zu diesem Zweck gebrauchte, denn sonst schlug sie damit gern gleichzeitig den Takt – und mir auf die Finger. Erst vermutete ich, sie wolle damit die Fruchtfliegen erledigen, was im Übrigen hätte erklären können, warum eine von ihnen das freiwillige Exil im Innern der Klaviatur gewählt hatte. Erst später verstand ich, dass meine Lehrerin mir immer dann unsanft auf die Finger klopfte, wenn ich zu langsam spielte. Und zu langsam spielte ich, wenn es nach ihr ging, eigentlich immer – es sei denn, dass ich zu schnell spielte. Da sie auch in diesen Fällen ihr Lineal als Fingerfallbeil einsetzte, wusste ich leider nie so recht, ob ich zu schnell oder zu langsam spielte. Klar war immerhin soviel: Ich spielte falsch.
»Was soll ich tun?«, fragte ich dann mit flehentlich bebender Stimme. »Du sollst besser spielen«, lautete stets die erschöpfende Antwort, und wenn ich mich weiter nachzufragen traute, hörte ich rätselhafte Orakelsprüche wie »Fleischiger!«, »Öliger muss es!« oder »Singen sollst du auf dem Klavier!« oder bestenfalls noch: »Du sollst dich mehr anstrengen.« Nur wenn sie gerade einen besonders freundlichen Tag hatte, was man ihr mitnichten ansehen konnte, fügte sie zur Abmilderung ihrer Verdikte hinzu: »Nimm eine Mandarine.«
Das war besondere Fürsorge. Fürsorge äußerte sich auch darin, welche Abwechslungen meine sowjetische Klavierlehrerin sich einfallen ließ, damit mir das Üben nicht langweilig würde. Alles, was mich irgendwie hinderte, war dabei – warum auch immer – recht. Bald sollte ich mit gekreuzten Armen spielen, bald platzierte sie auf meinem Handrücken eine Münze, die nicht herabfallen durfte, und auch wenn mir dies ausnahmsweise gelang, konnte ich sie doch nicht behalten – also die Münze. Meine sowjetische Klavierlehrerin behielt ich hingegen schon.
Da ich sie aber behielt, verband sie mir die Augen, damit sich die Bewegungen besser einprägten, während ich die Etüden schliff. Und derweil ich mit verbundenen Augen dasaß und spielte, versetzte ich mich in eine Fruchtfliege, taumelte hinüber auf die sowjetische Spanplattenkommode, krabbelte übers weiße sowjetische Häkeldeckchen zur sowjetischen Kristallglasschale, knabberte, um mich vor der bevorstehenden Anstrengung zu stärken, ein wenig an den verfaulten Mandarinen und flog durchs sowjetische Fenster in die postsowjetische Welt hinaus, als jüdischer Klavierflüchtling Richtung Westen, während mir meine Klavierlehrerin, mit dem Lineal den Takt vorgebend, hinterherrief: »Du sollst besser fliegen!«
Für die Idee zu diesem Text dankt der Autor der Pianistin Evgeniya Kleyn.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.