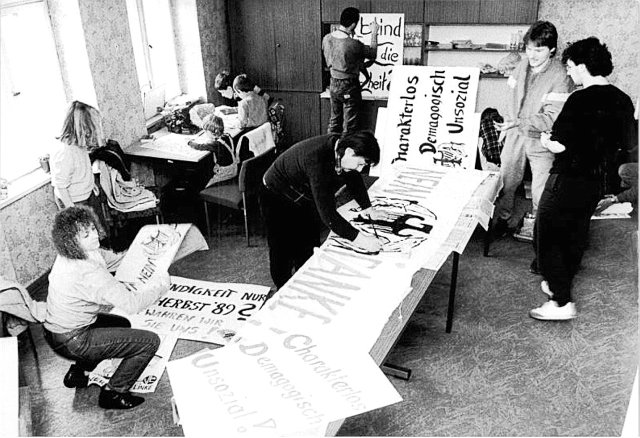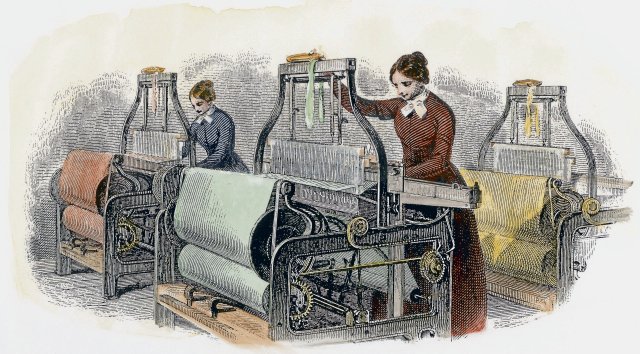- Kultur
- Thema Fernsehkonsum
Wie aussagekräftig sind TV-Quoten?
Chef der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im ND-Interview
Die GfK ermittelt die Programm- und die Werbereichweite. Unsere Messgeräte nehmen beides auf. Die werbeblockbezogene Information geht an Werbetreibende, Vermarkter und Agenturen. Sie wird nicht veröffentlicht.
ND: Sie geben Durchschnittswerte an. Wie kommen die zu Stande?
Wir ermitteln u.a. die durchschnittliche Sehbeteiligung, d. h. das Verhältnis der tatsächlichen Nutzungszeit zur möglichen Nutzungszeit. Wenn bei einem imaginären Panel von zwei Personen und einer Sendung von 100 Minuten Länge die eine Person 50 Minuten lang diese Sendung sieht und die andere den Apparat ausgeschaltet hat, haben wir 200 Minuten mögliche Sendezeit und eine Sehbeteiligung von 25 Prozent. Der Marktanteil ist der Anteil eines Senders an allen Personen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ferngesehen haben. Die Reichweite umfasst die Seher, die eine Sendung mindestens eine Minute lang beobachtet haben.
ND: Nun weiß jeder aus eigenem Erleben, dass in Werbepausen die Sender gewechselt werden. Beobachter gehen von einer U-förmigen Kurve aus, also einem Absinken der Zuschauerbeteiligung zu Beginn eines Werbeblocks und einer Rückkehr gegen Ende. Oft wird eine Faustformel von Programmreichweite minus 20 Prozent gleich Werbeblockreichweite kolportiert. Wie aussagekräftig ist diese Annahme?
Es gibt Unterschiede. Aber sie sind nicht mit einer Faustformel zu erfassen. Die Sehbeteiligung ist abhängig von der Lage des Werbeblocks im Programmumfeld. So wird die Werbung vor der »Tagesschau« mehr frequentiert als die Sendung davor, weniger jedoch als die »Tagesschau« selbst. In einem Werbeblock zwischen »heute«-Sendung und Wetterbericht fällt die Kurve kontinuierlich. In beiden Fällen verläuft sie linear. In einer Werbeinsel innerhalb eines TV-Movie kann sie hingegen eine U-Kurve beschreiben. Insgesamt ist der Verlauf nicht vorhersehbar. Die Sehbeteiligung ist durch ein Auf und Ab gekennzeichnet. Nicht nur das eigene Programm ist relevant, auch Konkurrenzprogramme beeinflussen die Kurve. Aber die Werbekunden bezahlen ohnehin nur für die Zuschauer im Werbeblock.
ND: Warum geben Sie nicht die spotgenauen Ratings heraus? Ist niemand daran interessiert?
Die Situation wird überhaupt nicht beklagt. Technisch hätten wir die Möglichkeit dazu. Es gibt aber eine Vereinbarung von Agenturen und Vermarktern, auf diese Daten zu verzichten. Der zusätzliche Arbeitsaufwand wäre im Verhältnis zu den relativ geringen Schwankungen nicht angemessen. Zudem garantieren die Sender ihren Kunden, dass die Position im Werbeblock ständig gewechselt wird.
ND: In der Zusammensetzung Ihres Panels überrascht der geringe Ausländeranteil von unter drei Prozent. Im Osten liegt er gar bei Null.
Das ist richtig. Das Statistische Bundesamt geht von einem Ausländeranteil von neun bis zehn Prozent, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, aus. Das Problem in der Marktforschung ist der Bezug auf die Grundgesamtheit. Über die deutsche Wohnbevölkerung in privaten Haushalten mit mindestens einem TV-Gerät wissen wir viel, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir uns auf die soziodemografischen Daten der Wahlberechtigten in den ca. 80000 Bundestagsstimmbezirken stützen können. Der Aufwand, verlässliche Informationen über Ausländer zu erhalten, ist extrem hoch. Wir könnten nicht dasselbe repräsentative Niveau wie bei den Deutschen garantieren. Jetzt haben wir aber die EU-Ausländer einbezogen und sind damit übrigens der Forschung in den Bereichen Radio oder Print voraus. Bislang stellen sich auch die Agenturen dagegen. Wenn sich nämlich die Zuschauerzahl um die Ausländer erhöht, könnten ja die Sender über kurz oder lang auf die Idee kommen, ihre Kunden für die zusätzlich nachgewiesenen Zuschauer auch mitbezahlen zu lassen.
ND: An dieser Situation könnte sich höchstens etwas ändern, wenn ein großer türkischer TV-Anbieter in die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung einsteigt?
Das Szenario ist ziemlich unwahrscheinlich.
ND: Wie können Sie sicherstellen, dass die Haushaltsmitglieder Ihres Panels sich auch ordnungsgemäß einloggen, wenn sie fernsehen und sich ausloggen, wenn sie den Raum verlassen?
Das Ein- und Ausloggen geht den betreffenden Personen nach kurzer Zeit in Fleisch und Blut über. Sie müssen nur einen Knopf mehr bedienen. Ungewöhnlich erscheinenden Nutzungszuständen gehen wir sofort nach. Zum Beispiel lief in einem Haushalt zwölf Stunden hintereinander ein Fernseher mit demselben Programm ohne Ummeldung und ohne Personenanmeldung. Der Rückruf ergab: »Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, lasse ich den Apparat für meine Katze an.« Während jährlicher Qualitätskontrollen lassen wir die Haushalte anrufen und fragen, wer fernsieht. Dabei kommt eine Quote von fünf Prozent heraus, die angibt, fernzusehen, sich aber nicht angemeldet hat. Weitere fünf Prozent haben vergessen sich abzumelden. Die Fehlerquellen sind also klein und minimieren sich gegenseitig. Aufmerksamkeit können wir nicht messen. Wir können nicht abschätzen, ob eine Nebenbeschäftigung den Zuschauer mehr in Anspruch nimmt als der Bildschirm. Der Mediensoziologe Alfons Silbermann sagte dazu einst: »Wer sagt, dass die, die beim Fernsehen bumsen, das Fernsehen als Nebentätigkeit empfinden?«
Fragen: Tom Mustroph
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.