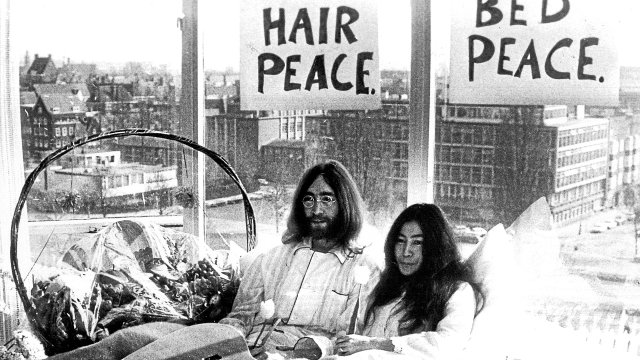Die Non-Sense mäht federleicht
Es wird geraucht und Sahnetorte vertilgt. So ziehen also Rauchschwaden auf, die Nebel breiten sich wallend aus, als strecke sich da ein Mensch, erwacht nach langem Schlaf im falschen Leben. Stimmt auch irgendwie. Martin Wuttke hat 200 Jahre geruht, war im Totnickerchen eingefroren und ist nun aufgetaut, da Nikotin und Fett die neuen Gesundmacher sind. Was in der unguten alten Zeit mit ihren so ganz anderen Rezepten für eine verlängerbare Existenz noch nicht erkannt, sondern sogar, mit Gurken- und Tomatenexzessen, bekämpft worden war. Aus der bitteren Hartz IV-Zeit ist wohl längst die glorreiche Quarz I-Ära geworden. In der man an der Universität Sexualtechnik und Poesie studieren kann, zudem wurden zur weiteren Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse des Volkes der Telesuperschirm und das Orgasmotron erfunden.
In strahlend blauer Epauletten-Uniform zwischen Faschings und Napoleons General qualmt und quäkt, strampelt und slapstickt, zuckt und zetert Wuttke sich durchs neue Stück von René Pollesch, »Schmeiß dein Ego weg!«, uraufgeführt an der Berliner Volksbühne. Ein köstlicher Disput-Salat, der lauter Unvereinbarkeiten mischt, Innen und Außen, Schein und Sein, Tradition und Trash, Sinn und Sprache; in Verkürzungen von drohend endlosen, verschraubten Theorielängen auf höchst intelligente Pointen liegt hier die Würze.
Pollesch geht mit der geschärften Non-Sense um, als sei sie eine Flaumfeder, die er durch eine wüst zerredete, total zerdachte Diskurswelt schweben lässt. Im Schwebeschwung wird gemäht. Nichts mehr bleibt vom neuzeitlichen Intellektualismus, der sich im Formulierungs- und Diffenzierungswettbewerb aus der klaren verbindlichen Haltung, aus dem Sinn für die wirklich sichtbaren Dinge des Lebens permanent herausdreht. Das ist von grandiosem Witz. Zumal das Theater selbst im Kreuzfeuer der verzweifelt gerufenen Fragen steht: Was ist die vierte Wand? Was haben Bühne und Publikum (noch) miteinander zu tun? Hin zur Hauptfrage: Was ist Seele, was ist Körper? Also: Wer sieht am Geldschein nicht nur das Aufgedruckte, wer sieht auch das Papier? Oder umgekehrt oder so.
Such allen (inneren) Wert nicht sonst wo, sondern sieh einfach hin und be-greif alles im Greifbaren. Das begreife einer!
Jedenfalls: dass die Seele sich nicht innen befindet, sondern der Körper ist, der sich kratzt – für diesen Gedanken rast Wuttke. Tobt auf der Vorbühne der Volksbühne, vorm Imitat der Zuschauerwand, die Bert Neumann als tatsächliche vierte Wand hinbaute, und die natürlich aufgebrochen wird – um dahinter das Spiel einer Videokamera zu ermöglichen, die dem Wühlen nach der Wahrheit im Sichtbaren oder Unsichtbaren neues Spaßfutter gibt.
Wer alle Sinnspruchakrobatik verstehen will, wird schnell kapitulieren, hier hat man sich einem Rhythmus hinzugeben, einer so abstrusen wie abstrahierenden Wortmelodie, die auf die Brüchigkeit der Techniken verweist, uns einander zu vermitteln. Das vermittelt sich schlichtweg toll!
Ein berückend sauber intonierender achtköpfiger Chor sieht in weißen Ganzkörperanzügen aus, wie von Woody Allens Film-Spermien-Kollektiv geborgt. Christine Groß spielt eine Art Vernunft- und Verständnis-Verbindungsteil (»Ich bin der Pluralismus«) zwischen dem explodiergefährdeten Wuttke und seiner Geliebten: Das ist Margit Carstensen, die wunderbar adelsalte Schöne aus der Fassbinder- und Schlingensief-Zeit. Sie braucht nur zu fragen, wie das gehen solle, miteinander zu sprechen, und die ganze liebenswerte Verdutztheit eines vom fiebernden Wuttke-Bewusstsein überforderten »gewöhnlichen« Lebens scheint auf, wie ein Diadem.
Zum Schluss des einstündigen Abends große Filmmusik, und die Carstensen, ihrem theoriehechelndenden Faschingsgeneral zugeneigt, sagt tiefernste, liebesgläubige Sätze, die berührend aussteigen aus allen Betriebsheiterkeiten des Theaters. Pollesch plötzlich pathosstark. Dazu Pink Floyd. Du löst dich gleichsam auf im Theatersessel, würdest jetzt glatt dein Ego wegschmeißen. Aber wohin, und wer will es haben?
Nächste Vorstellung: 20.1.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.