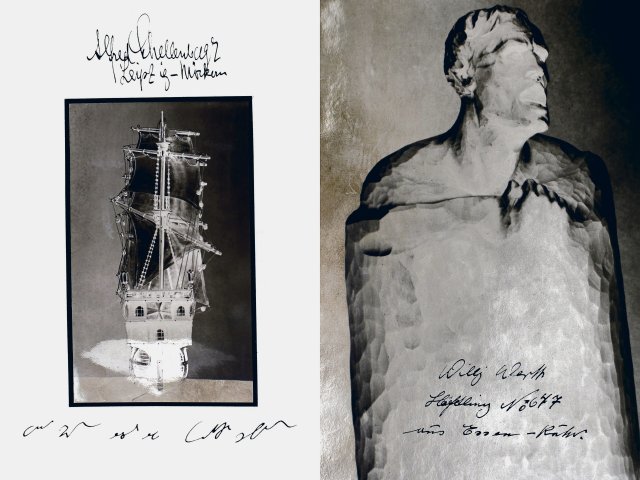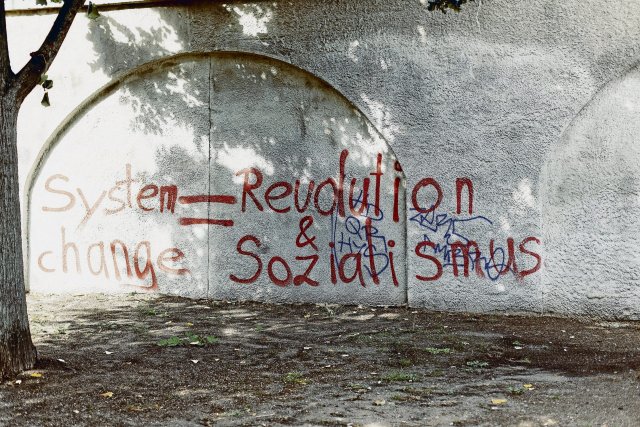- Kultur
- Buchmesse Leipzig
Ob nun Schwarze oder Weiße ...
RASSISMUS
Warum gibt es noch immer Rassismus in Deutschland? Das ist die Frage, die Heike Schneider umtrieb. Sie hat acht Interviews geführt, mit »durchweg sympathischen, wachen Menschen«, wie der Leser nach deren Lektüre bestätigen wird. Die hier vorgestellten Biografien zwischen Lenningen und Leipzig, Berlin, Heidelberg und Jena, Göttingen und Dresden, Hannover und Darß weisen eine Besonderheit auf: Es sind Bürger mit Migrationshintergrund (wahrlich ein sperriges Wort), mit Wurzeln in Palästina, der Türkei, Vietnam, Iran und afrikanischen Staaten.
Die Autorin, aufgewachsen in der DDR, erinnert sich an ein Kinderlied – »ob nun Schwarze oder Weiße, Gelbe oder Braune« –, an gemeinsames Rodeln am Fichtelberg mit Vietnamesen, an Kommilitoninnen aus Kongo, Ghana und Tansania, die in der Gemeinschaftsküche des Studentenwohnheims in Leipzig exotische Gerichte kochten und an afrikanische Kollegen beim Rundfunk in Berlin. Die spätere Afrikakorrespondentin hat eine internationalistische Erziehung genossen. Diese lässt sie erzürnen über rassistische Vorurteile und Gewalttaten im heutigen Deutschland, über »Feigheit, fehlende Zivilcourage und kein Mitgefühl – ein Skandal«. Ein persönliches Motiv kommt hinzu. Ihr namibischer Adoptivsohn hatte nach der Vereinigung böse Erfahrungen gemacht. Nur die Judo-Kunst bewahrte ihn davor, von jungen Neonazis in der S-Bahn zusammengeschlagen zu werden. Wie er können auch die von seiner Mutter interviewten, einst in der DDR lebenden Ausländer dem untergegangenen ostdeutschen Staat bescheinigen, frei von Rassismus gewesen zu sein. Gewiss, die soziale Situation war eine andere, der Ausländeranteil nicht so hoch wie heute. Und doch muss es auch am Wesen dieses Staates gelegenen haben, dass es nicht diese Ausschreitungen gegen »Fremde« wie heute gab. Die Diplom-Kauffrau Maria Bellini (Jg. 1971), mehrfache Spartakiade-Siegerin, glaubt aber, dass ihr eine internationale Sportkarriere damals nicht gelang, weil die DDR im Ausland nicht mit einer Afrikanerin gegen Afrikaner antreten wollte.
Nestwärme spürte Stefanie-Lahya, Jg. 1978, in der DDR; sie hat vor Kurzem selbst ein Buch veröffentlicht: »Kalungas Kind – Wie die DDR mein Leben rettete«. Ähnliches berichtet die 1963 in Dresden als Tochter eines Medizinstudenten aus Somalia und einer Dresdner Journalistin geborene Samira Anna Zufi. Und im neuen, größeren Deutschland? Ihre in einem »kleinstädtischen Kaff bei Hamburg« lebende Schwiegermutter habe nach der Geburt ihres ersten Kindes, blond, blauäugig und hellhäutig, aufgeatmet: »Na, dann sei mal froh, dass es so gekommen ist.« Die 1980 geborene Projektmanagerin Mona Katawi mit palästinensischem Familienhintergrund findet die Kopftuch-Debatte »überheblich im rassistischen Sinne, obwohl sie nicht zu Sarrazins »Kopftuchmädchen« gehört. Dass »wir Türken von Deutschen oft wie Abziehbilder behandelt und beschrieben werden«, ärgert Melda Akbas (Jg. 1991).
Mit Integration und Assimilation haben die Interviewten kein Problem. Der in Göttingen tätige Psychotherapeut Mohammad Ebrahim Ardjomandi (Jg. 1932) sagt: »Ich bin ein Mensch, der in zwei Kulturen denkt und lebt – in der iranischen und in der deutschen.«
Der von der UNO einberufene Internationale Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminierung steht wieder bevor: am 21. März. Gute Gelegenheit, dieses Buch in Schulen zu diskutieren. Oder auch in den folgenden Tagen und Wochen. Und nicht nur in den Schulen.
Heike Schneider: Schlüpf doch mal in meine Haut. Acht Gespräche über Alltagsrassismus in Deutschland. Militzke. 224 S., geb., 19,90 €.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.